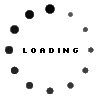Klimaanlage nachrüsten: Was gibt es zu beachten?
Immer mehr Eigenheimbesitzer überlegen, eine Klimaanlage installieren zu lassen, um im Sommer für angenehme Temperaturen zu sorgen. Doch welche Systeme eignen sich für bestehende Häuser?
2025-04-09 00:00:00 2025-04-09 00:00:00 admin
In diesem Ratgeber erfahren Sie, welche Arten von Klimaanlagen es gibt, was beim Nachrüsten beachtet werden muss und mit welchen Kosten Sie für Kauf, Installation und Betrieb rechnen sollten. Außerdem stellen wir aktuelle Top-Modelle vor, beleuchten Förderprogramme in Deutschland und geben Tipps zur Wahl des Fachbetriebs. Nicht zuletzt finden Sie eine praktische Checkliste, damit beim Nachrüsten Ihrer Klimaanlage nichts Wichtiges übersehen wird.
Arten von Klimaanlagen für die Nachrüstung
Beim Nachrüsten einer Klimaanlage im Eigenheim stehen verschiedene Gerätetypen zur Auswahl. Jede Variante hat spezifische Vor- und Nachteile in Bezug auf Kühlleistung, Effizienz, Installationsaufwand und Kosten. Im Folgenden ein Überblick über die gängigsten Klimaanlagen-Arten:
Mobile Monoblock-Klimageräte (mobiles Einzelgerät)
Monoblock-Klimaanlagen sind kompakte, mobile Geräte, die komplett in einem Gehäuse untergebracht sind. Sie werden einfach im Raum aufgestellt und über einen Abluftschlauch mit der Außenluft verbunden.
-
Vorteile: Günstig in der Anschaffung (ab ca. 200 €) und flexibel einsetzbar, da keine feste Installation erforderlich ist. Sie können das Gerät bei Bedarf von Raum zu Raum bewegen. Die Inbetriebnahme ist einfach: Stecker in die Steckdose, Abluftschlauch durchs Fenster – fertig. Ideal für Mieter, da keine baulichen Änderungen nötig sind.
-
Nachteile: Deutlich geringere Energieeffizienz. Monoblock-Geräte verbrauchen mehr Strom und kühlen weniger effektiv als Split-Anlagen. Durch den Abluftschlauch, der meist durch ein gekipptes Fenster geführt wird, strömt warme Luft ständig wieder ins Zimmer nach. Dies mindert die Kühlleistung erheblich und erhöht den Stromverbrauch. Im Warentest 2021 erreichte kein mobiles Klimagerät eine gute Note – alle getesteten Monoblöcke schnitten nur „ausreichend“ ab. Zudem sind sie vergleichsweise laut (da Kompressor und Lüfter im Raum stehen) und die warme Abluft muss abgeführt werden (Fensterabdichtung erforderlich). Für größere Räume stoßen mobile Geräte leistungsmäßig an ihre Grenzen.
Split-Klimaanlagen (Single-Split)
Split-Geräte bestehen aus zwei Teilen: einer Inneneinheit (Verdampfer) im zu kühlenden Raum und einer Außeneinheit (Kondensator mit Kompressor) außerhalb des Gebäudes. Beide Einheiten sind durch Kältemittelleitungen und Elektrokabel verbunden. Dieses System ist fest installiert.
-
Vorteile: Hohe Kühlleistung und Effizienz. Split-Klimaanlagen arbeiten wesentlich energieeffizienter als Monoblocks – der Kompressor befindet sich außen, sodass keine warme Abluft durch ein offenes Fenster hereinströmt. Moderne Inverter-Splitgeräte erreichen oft Energieeffizienzklasse A++ oder A+++ im Kühlbetrieb. Sie sind zudem deutlich leiser im Innenraum, da die lautesten Komponenten draußen installiert sind. Viele Modelle können neben Kühlen auch Heizen (Wärmepumpen-Funktion) und im Winter als Heizungsunterstützung dienen. Dies erhöht den Nutzwert und kann sie förderfähig machen (Details zu Förderungen später).
-
Nachteile: Höherer Installationsaufwand. Für die Kältemittelleitungen muss eine Wanddurchführung (Bohrung ~5–7 cm) geschaffen werden. Die Außeneinheit benötigt einen Platz an Fassade, Dach oder Boden. Die Installation darf aufgrund der Kältemittel nur von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten (typisch mehrere hundert Euro). Baulich müssen Wanddurchbrüche und Halterungen für das Außengerät eingeplant werden. Optisch verändert ein Außengerät die Fassadenansicht – in Reihenhaussiedlungen oder bei Eigentümergemeinschaften muss dies mitunter abgestimmt werden. Trotz dieser Hürden sind Split-Klimaanlagen die effektivste Lösung für dauerhafte Klimatisierung einzelner Räume.
Multisplit-Anlagen (mehrere Innengeräte)
Multisplit-Systeme funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie Single-Splits, jedoch versorgt eine Außeneinheit mehrere Innengeräte (z.B. in verschiedenen Räumen). Typisch sind Multisplit-Klimaanlagen mit 2 bis 5 Inneneinheiten.
-
Vorteile: Mehrere Räume klimatisieren mit nur einem Außengerät. Das spart Platz an der Fassade und kann optisch ansprechender sein, als für jeden Raum ein eigenes Außengerät zu montieren. Jede Inneneinheit kann individuell geregelt werden (Temperatur, An/Aus). Für mittelgroße Wohnungen oder Einfamilienhäuser lassen sich so mit einer Anlage mehrere Schlafzimmer, Wohnzimmer etc. kühlen.
-
Nachteile: Hohe Anschaffungskosten. Multisplit-Systeme sind teurer als einzelne Splitgeräte, da die Außeneinheit leistungsstärker dimensioniert sein muss und die Installation komplexer ist. Pro zusätzlichem Innengerät fallen weitere Leitungen, Kernbohrungen und Montagearbeiten an. Die Installationskosten summieren sich mit ca. 250 € pro weiterem Innenteil schnell auf beträchtliche Beträge. Zudem muss die Leistung der Außeneinheit genau geplant werden, damit alle Räume ausreichend versorgt werden können – hier ist eine saubere Kühllast-Berechnung durch den Fachplaner wichtig.
Zentrale Klimaanlagen (zentralisierte Kühlung)
Unter zentralen Klimaanlagen versteht man fest eingebaute Systeme, die meist über Lüftungskanäle oder ein zentrales Luftverteilsystem das ganze Gebäude kühlen. Solche Lösungen finden sich häufig in Bürobauten. In Wohnhäusern sind sie seltener, können aber etwa bei umfangreichen Sanierungen oder in sehr großen Häusern nachgerüstet werden.
-
Vorteile: Eine zentrale Lösung kann mehrere Räume oder das ganze Haus gleichmäßig kühlen, ohne in jedem Raum ein eigenes Innengerät an der Wand zu haben. Die Luftverteilung erfolgt über Kanäle in Decken oder Wänden – die Klimatisierung ist sozusagen „unsichtbar“. Optisch sind nur Luftauslässe sichtbar. Zentrale Anlagen können oft auch filtern und die Frischluftzufuhr regeln (Kombination mit Lüftungsanlage).
-
Nachteile: Sehr hoher baulicher Aufwand. Das Nachrüsten von Luftkanälen in einem Bestandsgebäude erfordert erhebliche Eingriffe (Deckenkonstruktionen, Schächte). Deshalb kommen zentrale Klimaanlagen vor allem bei Neubau oder Komplettumbau in Betracht. Die Kosten liegen deutlich höher als bei dezentralen Splitgeräten, und ein Fehler in der Planung kann die Effizienz beeinträchtigen. Für normale Einfamilienhäuser sind zentrale Systeme meist overkill. In Bestandsbauten greift man stattdessen eher zu Multisplit-Lösungen, bei denen nur kleine Leitungen verlegt werden müssen statt großer Lüftungskanäle.
Luft-Luft-Wärmepumpen (Klimaanlagen mit Heizfunktion)
Luft-Luft-Wärmepumpen sind im Prinzip Klimaanlagen, die auch heizen können. Tatsächlich handelt es sich bei jeder modernen Split-Klimaanlage mit Heizmodus um eine kleine Luft-Luft-Wärmepumpe: Im Sommer wird Wärme aus dem Innenraum nach draußen transportiert (Kühlmodus), im Winter kann der Kreislauf umgekehrt werden und die Pumpe zieht Wärme von draußen ins Haus (Heizmodus).
-
Vorteile: Doppelfunktion Kühlen und Heizen. In der warmen Jahreszeit sorgt die Anlage für Kühlung, in der Übergangszeit oder an milden Wintertagen kann sie effizient heizen. Viele Hersteller bieten spezielle Innengeräte mit erweiterten Filter- und Luftreinigungsfunktionen an (z.B. gegen Pollen, Gerüche), da diese Geräte ganzjährig laufen könnten. Förderfähig: Weil solche Klimaanlagen als Wärmepumpe gelten, sind sie unter bestimmten Bedingungen durch staatliche Programme förderfähig (siehe Fördermittel). Sie erreichen teils hohe Heiz-Energieeffizienzwerte (SCOP > 4) und können so die Zentralheizung entlasten.
-
Nachteile: Höhere Anschaffungskosten im Vergleich zu reinen Kühlgeräten, da die Technik für den Heizbetrieb optimiert ist. Sie lohnen sich vor allem, wenn man die Heizfunktion auch nutzen möchte. In sehr kalten Wintern stoßen Luft-Luft-Wärmepumpen an Effizienzgrenzen und benötigen oft eine zusätzliche Heizmöglichkeit. Außerdem bleibt es ein Einzelraum-Heizsystem – für ein ganzes Haus als alleinige Heizung sind Multisplit-Wärmepumpen nötig, was vergleichbar mit einer zentralen Heizung vom Aufwand ist.
Fazit der Gerätetypen: Für die meisten Eigenheimbesitzer, die eine Klimaanlage nachrüsten wollen, werden Split-Klimageräte die beste Wahl sein – sie bieten ein gutes Verhältnis von Leistung zu Betriebskosten. Mobile Geräte eignen sich eher als Übergangslösung oder für Mietwohnungen. Multisplit-Systeme sind sinnvoll, wenn mehrere Räume gekühlt werden sollen. Eine Heizfunktion (Luft-Luft-Wärmepumpe) ist ein großer Pluspunkt hinsichtlich Ganzjahresnutzung und Förderung.
Nachrüsten planen: Voraussetzungen und Installationsaufwand
Bevor Sie eine Klimaanlage installieren lassen, sollten Sie die baulichen Voraussetzungen und den Installationsaufwand genau prüfen. Je nach gewähltem System gibt es wichtige Punkte, auf die Sie achten müssen:
-
Platz für die Außeneinheit: Bei Split- und Multisplit-Anlagen benötigt das Außengerät einen geeigneten Standort am Gebäude. Häufig wird es an der Außenwand in Höhe der Inneneinheit montiert (Konsolen) oder auf dem Boden bzw. Flachdach aufgestellt. Achten Sie auf ausreichenden Abstand zum Nachbargrundstück – die Geräte erzeugen Geräusche und dürfen nachts bestimmte Schallpegel am Nachbargrundstück nicht überschreiten (Stichwort TA Lärm, nachts meist max. 35 dB(A) an der Grundstücksgrenze). Ein schattiger Platz ist ideal, denn direkte Sonne reduziert die Effizienz
. Klären Sie zudem, ob die Optik (z.B. in einer Reihenhausanlage oder Wohnanlage) abgestimmt werden muss. In denkmalgeschützten Gebäuden kann eine Außeneinheit problematisch sein.
-
Wanddurchbruch: Für Split-Systeme muss ein Loch durch die Außenwand gebohrt werden (ca. 5–7 cm Durchmesser) um die Kältemittelleitungen, Kondensatablauf und Steuerkabel ins Freie zu führen. Diese Kernbohrung sollte idealerweise in der Nähe der Inneneinheit erfolgen (meist hinter dem Wandgerät), um Leitungswege kurz zu halten. Prüfen Sie, ob an dieser Stelle Leitungen in der Wand liegen (Strom, Wasser), die das Bohren erschweren. Auch muss die Wand geeignet sein (bei Fachwerk oder dünnen Wänden ist besondere Sorgfalt geboten).
-
Stromanschluss: Klimageräte benötigen Strom (230 V). Mobile Geräte kann man einfach in eine Steckdose stecken. Bei fest installierten Anlagen sollte ein separater Stromkreis mit Absicherung vorhanden sein, insbesondere bei größeren Multisplit-Systemen. Oft übernimmt der Klimafachbetrieb den elektrischen Anschluss mit. Lassen Sie ggf. einen Elektriker eine Zuleitung legen, wenn in gewünschter Nähe keine Steckdose oder Leitung mit ausreichender Absicherung verfügbar ist.
-
Kondensat-Entwässerung: Im Kühlbetrieb fällt an der Inneneinheit Kondenswasser an (durch das Entfeuchten der Luft). Dieses Wasser muss abgeführt werden. Üblich ist eine Kondensatleitung nach draußen (oft im selben Wanddurchbruch nach außen geführt, dort Ablaufen an der Fassade oder in ein Fallrohr). Alternativ kann man das Kondensat in einen Abfluss im Haus leiten (wenn das Gefälle reicht) oder es muss eine Pumpe installiert werden, die das Wasser nach draußen befördert. Planen Sie diesen Aspekt mit ein – unsachgemäße Kondensatableitung kann Feuchtschäden verursachen.
-
Baugenehmigung und Vorschriften: Grundsätzlich ist der Einbau einer einzelnen Split-Klimaanlage am Einfamilienhaus genehmigungsfrei. In Wohnungseigentümergemeinschaften (Eigentumswohnungen) braucht es allerdings die Zustimmung der Gemeinschaft, wenn die Fassade verändert wird. Mieter benötigen die Erlaubnis des Vermieters. Beachten Sie auch kommunale Vorschriften, etwa ob Außengeräte zur Straßenseite erlaubt sind. Bei zentralen Anlagen oder großen VRF-Systemen könnten baurechtliche Auflagen greifen – in solchen Fällen unbedingt vorher beim Bauamt oder einem Fachplaner nachfragen.
-
Zeitraum für die Installation: Planen Sie die Montage möglichst außerhalb von Hitzewellen. Gute Kälte-Klima-Fachbetriebe sind im Hochsommer oft Wochen im Voraus ausgebucht. Ideal ist es, eine Klimaanlage im Frühjahr oder Herbst nachrüsten zu lassen, bevor extreme Temperaturen herrschen. Dann ist die Terminfindung einfacher und die Installation kann in Ruhe erfolgen, bevor Sie die Kühlung wirklich benötigen.
Insgesamt sollte man beim Nachrüsten genügend Zeit für die Planung einplanen. Eine gute Abstimmung mit einem erfahrenen Fachbetrieb schon in der Planungsphase hilft, böse Überraschungen (unzureichende Kühlleistung, Lärmprobleme, undichte Leitungen etc.) zu vermeiden.
Kosten für Anschaffung und Einbau
Die Kosten einer Klimaanlage setzen sich im Wesentlichen aus den Anschaffungskosten für das Gerät und den Installationskosten zusammen. Diese können je nach Gerätetyp stark variieren. Die folgende Tabelle gibt einen groben Überblick über die Kosten verschiedener Klimaanlagen-Arten:
| Klimaanlagen-Typ | Anschaffung (ca.) | Installation (ca.) |
|---|---|---|
| Mobiles Monoblock-Gerät | ab 200 € (einfache Geräte) bis 700 € (Markenmodell) | kaum Aufwand – selbst aufstellbar, Fensterabdichtung für Abluft (~50 €) |
| Split-Klimaanlage (ein Raum) | ab 1.000–1.500 € (Einsteigergerät) bis 2.500 € (Premium-Modell) | ~300–800 € durch Fachbetrieb (inkl. Wanddurchbruch, Montage und Inbetriebnahme) |
| Multisplit (2–3 Räume) | ca. 2.000–5.000 € (je nach Anzahl und Leistung der Inneneinheiten) | ab ~800 € (für 2 Räume) aufwärts; pro zusätzlichem Innengerät etwa +200–300 € Installationskosten |
| Zentrales Klimasystem | meist > 5.000 € (Anlage + Kanäle) | Sehr hoch: umfangreiche Umbauten für Luftleitungen nötig, Einbau oft mehrere Tausend Euro |
| Luft-Luft-Wärmepumpe (Split mit Heizfunktion) | ca. 10–20 % teurer als reines Split-Gerät gleicher Leistung (z.B. 1.500–3.000 € je Gerät) | vergleichbar mit Split: 300–800 € pro Gerät (zusätzliche Einstellungen für Heizbetrieb durch Fachfirma) |
Stand der Preise: 2025. Die angegebenen Werte dienen als Orientierungsrahmen und können je nach Hersteller, Region und individueller Situation variieren.
Wie man sieht, sind mobile Geräte zunächst am günstigsten, allerdings ist ihr Preis pro gekühlter Leistung hoch, da oft mehrere Geräte nötig sind, um die Wirkung einer einzigen Split-Anlage zu erreichen. Split-Klimaanlagen haben höhere Anschaffungskosten, bieten dafür aber deutlich bessere Leistung und Effizienz. Bei Multisplit und Zentralanlagen steigen die Kosten entsprechend der Komplexität.
Installationskosten sparen? Laien ist davon abzuraten, ein Split-Gerät in Eigenregie zu installieren. Gesetzlich darf die Inbetriebnahme ohnehin nur mit Sachkundenachweis (zertifizierter Kälte-Klima-Techniker) erfolgen, da der Umgang mit Kältemitteln geregelt ist. Selbst wenn man theoretisch ein günstiges Split-Set kauft: Ohne Fachbetrieb geht es nicht. Die Installationskosten sind also ein Fixposten. Allerdings kann man Angebote vergleichen – manche Firmen bieten Pauschalpakete „Gerät + Einbau“ zum Festpreis an. Das kann unterm Strich günstiger sein, als Gerät und Einbau getrennt zu organisieren, da der Fachbetrieb so Planungssicherheit hat.
Betriebskosten und Wartung
Neben den einmaligen Anschaffungskosten sollten Sie auch die laufenden Kosten einer Klimaanlage berücksichtigen:
-
Stromverbrauch: Klimageräte benötigen zum Kühlen elektrische Energie. Moderne Split-Klimaanlagen arbeiten allerdings sehr effizient. Beispielsweise verbraucht ein durchschnittliches Split-Klimagerät für einen 25 m² Raum etwa 0,7–1 kWh Strom pro Stunde Kühlbetrieb. Bei einem Strompreis von 0,30 € entspricht das ~0,21–0,30 € pro Betriebsstunde. Mobile Monoblock-Geräte sind weniger effizient und können etwa 0,40 € pro Stunde kosten, weil sie mehr Leistung aufnehmen und dabei auch noch warme Luft hereinholen. Die tatsächlichen Stromkosten hängen von der Nutzungsdauer ab: Ein Gerät, das nur an sehr heißen Tagen wenige Stunden läuft, verbraucht übers Jahr vielleicht 50–100 kWh (ca. 15–30 € Stromkosten). Ein Klimagerät, das im Dauereinsatz täglich läuft, kann mehrere hundert Euro an Stromkosten im Jahr verursachen. Tipp: Achten Sie auf eine hohe Energieeffizienzklasse (mindestens A+ oder besser) und einen hohen SEER-Wert (Seasonal Energy Efficiency Ratio) – diese Kennzahlen zeigen an, wie stromsparend das Gerät über die Kühlperiode arbeitet. Und: Nutzen Sie eine Timer- oder Smarthome-Steuerung, um die Klimaanlage nur bei Bedarf laufen zu lassen, und kühlen Sie nicht stärker als nötig (Empfehlung: Raum nicht kälter als 6 °C unter Außentemperatur, um Energie zu sparen).
-
Wartungskosten: Eine Klimaanlage ist wartungsarm, aber regelmäßige Checks verlängern die Lebensdauer. Filter reinigen oder wechseln: Die Innenraumfilter sollten alle paar Wochen geprüft und bei Bedarf abgesaugt oder gewaschen werden (je nach Gerätetyp). Das kann der Nutzer selbst tun. Fachgerechte Inspektion: Etwa alle 1–2 Jahre ist es ratsam, eine Wartung durch den Fachbetrieb durchführen zu lassen. Dabei werden Kältemitteldruck, Dichtigkeit, elektrische Anschlüsse und die Leistung überprüft, sowie eine Reinigung der Wärmetauscher (Innen- und Außengerät) vorgenommen. Kostenpunkt: ca. 100–200 € je nach Aufwand. Gesetzlich vorgeschrieben sind regelmäßige Dichtigkeitsprüfungen nur bei größeren Kältemittel-Füllmengen (meist > 5 to CO₂-Äquivalent, was bei kleinen Split-Geräten nicht erreicht wird). Trotzdem sollte man, um Effizienzverluste zu vermeiden, die Anlage pflegen lassen. Langlebigkeit: Qualität zahlt sich aus – hochwertige Markengeräte können 15 Jahre und länger halten, wenn sie gewartet werden. Bei Billiggeräten kann es früher zu Kompressor- oder Elektronikschäden kommen. Instandsetzungen (Kältemittel nachfüllen, Teile tauschen) können dann mehrere hundert Euro kosten. Wer gleich auf ein gutes Gerät und solide Installation setzt, spart oft langfristig.
Zusammengefasst sind die Betriebskosten moderner Klimaanlagen beherrschbar, solange man die Geräte vernünftig einsetzt. Gerade die Heizfunktion (bei Wärmepumpen-Klimaanlagen) kann sich in der Übergangszeit sogar kostenneutral oder positiv auswirken, wenn z.B. mit einem sehr effizienten Klimagerät geheizt wird statt mit einem alten Kessel. Beachten Sie aber, dass Strom gegenüber Gas oder Öl teurer sein kann; hier hilft ein Tarif für Wärmepumpenstrom oder eigener PV-Strom, um die Kosten zu senken.
Hersteller und Modelle: Empfehlenswerte Klimaanlagen
Der Markt für Klimageräte ist in den letzten Jahren gewachsen. Es gibt zahlreiche Hersteller – von spezialisierten Klimaanlagen-Marken aus Japan bis hin zu preisgünstigen Importgeräten. Bei der Wahl hilft ein Blick auf Testberichte und Vergleiche (z.B. von Stiftung Warentest, ETM Testmagazin, etc.). Im Folgenden einige aktuelle empfohlene Modelle und Hersteller, die in Tests gut abgeschnitten haben:
| Hersteller / Modell | Typ | Besonderheiten & Bewertung | Preis (ca.) |
|---|---|---|---|
| Bosch CLC8001i-W 25 E + CLC8001i 25 E | Split (2,5 kW) | Stiftung Warentest Testsieger 2024 – sehr effizient im Kühl- und Heizbetrieb. Präzise Temperaturregelung, langfristig kostengünstig. | ~1.500 € |
| Daikin FTXJ25AW + RXJ25A (Emura) | Split (2,5 kW) | Stiftung Warentest Testsieger 2023 (Gesamtnote „Gut (2,0)“). Herausragende Energieeffizienz, schnelle Abkühlzeit und sehr leise im Betrieb. Edles Design (flaches Wandgerät). | ~1.700 € |
| Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W + SRC25ZS-W2 | Split (2,5 kW) | Ebenfalls „Gut“ (Note 2,5) bei Warentest 2023. Sehr gute Kühlleistung (bis 3,0 kW erreicht mehr als angegeben) und leiser Innengerät-Betrieb. Solides Preis-Leistungs-Verhältnis. | ~1.000 € (Set) |
| Fujitsu ASYG09KGTF + AOYG09KGCA | Split (2,5 kW) | In Warentest 2024 unter den Top 3. Taugt auch zum Heizen („gut“ im Heiztest). WLAN-Steuerung integriert. Fujitsu punktet mit hoher Zuverlässigkeit. | ~2.200 € |
| Midea PortaSplit 12K | Mobiles Split | Innovative mobile Split-Klimaanlage (Innen- und Außenteil via flexible Leitung verbindbar). Keine feste Installation nötig, dadurch mobil einsetzbar, aber Leistung einer Split-Anlage. Ideal für Mietwohnungen, vom German Design Award 2024 prämiert. | ~1.300 € |
| De'Longhi Pinguino PAC EX120 Silent | Monoblock mobil | Einer der Testsieger bei mobilen Geräten (u.a. ETM Testmagazin). Gute Kühlleistung für Räume < 30 m², relativ leise für ein mobiles Gerät. Energieeffizienzklasse A. Bewährtes Modell für alle, die kein Split installieren können. | ~800 € |
| Mitsubishi Electric MSZ-LN (Diamond Serie) | Split (2,5–5 kW) | Premium-Serie mit sehr leisen Innengeräten (Schalldruck ab 19 dB(A)), in Designfarben (Weiß, Silber, Schwarz, Rot) erhältlich. Hohe SEER/SCOP-Werte, integrierte Sensorik und Luftreinigung. Marktführer in Sachen Qualität. | je nach Leistung 1.800–3.000 € |
| Panasonic Etherea Reihe | Split (var. kW) | Bekannte Serie mit hoher Zuverlässigkeit. Gute Testwerte in vergangenen Vergleichen, oft sehr gute Effizienz und langlebiger Inverter. Viele Modelle mit WLAN und Sprachsteuerung. | ~1.200–2.500 € |
Hinweis: Preise können je nach Händler und Installationspaket schwanken. Bei Split-Geräten kommen die Installationskosten hinzu (siehe oben). Die Liste zeigt beispielhaft einige Modelle mit guter Bewertung – es gibt natürlich noch weitere empfehlenswerte Marken (z.B. Toshiba, LG, Hitachi, Gree, Haier etc.). Achten Sie bei der Auswahl auf Testergebnisse und Erfahrungsberichte. Ein Klimafachbetrieb kann Ihnen zudem Geräte empfehlen, mit denen er gute Erfahrungen hat.
Wie sichtbar, dominieren bei den Split-Klimaanlagen asiatische Hersteller (Japan, China, Korea) den Markt – diese haben jahrzehntelange Erfahrung in der Kältetechnik. Deutsche Anbieter wie Bosch oder Viessmann lassen oft bei solchen Spezialisten fertigen oder vertreiben zugekaufte Geräte unter eigenem Namen. Es lohnt sich also, genauer hinzusehen: Oft steckt in einer Klimaanlage von Marke X die Technik von Hersteller Y. Letztlich sind Verarbeitung, Effizienz und Service wichtige Kriterien. Die oben genannten Testsieger zeigen, dass Bosch, Daikin, Mitsubishi, Fujitsu und Midea aktuell zu den Top-Performern gehören. Wichtig: Egal für welches Gerät Sie sich entscheiden – stellen Sie sicher, dass es für die zu kühlende Raumgröße ausgelegt ist (Kühlleistung in kW passend zur Quadratmeterzahl) und dass es einen fachgerechten Einbau erfährt.
Förderprogramme und Zuschüsse in Deutschland
Seit einigen Jahren fördert der Staat den Einbau energieeffizienter Wärmepumpen – und dazu zählen unter bestimmten Umständen auch Klimaanlagen. Allerdings: Reine Klimageräte zum Kühlen (ohne Heizfunktion) werden für Privatleute nicht bezuschusst. Förderfähig sind Klimaanlagen mit Heizfunktion (also Luft-Luft-Wärmepumpen), insbesondere wenn sie im Bestand eingebaut werden, um eine alte Heizung zu ergänzen oder zu ersetzen. Hier die wichtigsten Förderprogramme und Bedingungen:
| Programm / Förderung | Voraussetzungen & Bedingungen | Förderhöhe / Leistung |
|---|---|---|
| BAFA – Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG EM) Zuschuss für Einzelmaßnahmen |
– Luft-Luft-Wärmepumpe (Split-Klimaanlage mit Heizmodus) in einem Bestandsgebäude. – Gerät muss bestimmte Effizienzkennwerte erfüllen (jahreszeitliche Raumheiz-Energieeffizienz η<sub>s</sub> ≥ 181% bei ≤12 kW) – Antrag vor Kauf/Installation stellen. – Anlage muss überwiegend dem Heizen dienen (Kühlen ist als Zusatznutzen okay). |
Basisförderung 25 % der Kosten. Bonus +10 % wenn alte Heizung ersetzt wird („Heizungstausch“) und weitere Boni möglich (z.B. Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln). Maximal bis ~40 % Zuschuss erreichbar. Auszahlung als Zuschuss durch BAFA nach Umsetzung. |
| KfW – Kredit 262 / Zuschuss 461 (Wärmepumpe im Wohngebäude) |
– Im Prinzip gleiche Voraussetzungen wie BAFA (Luft/Luft-Wärmepumpe im Bestandsbau). – Kombination aus zinsgünstigem Darlehen und Tilgungszuschuss möglich, wenn die Klimaanlage als Heizungsersatz dient. – Für Eigentümer von selbstgenutztem Wohneigentum. |
Tilgungszuschuss bis zu 50 % über die KfW, kombiniert mit BAFA-Förderung effektiv bis zu 70 % Gesamterstattung möglich. Beispiel: Wird eine Ölheizung durch eine Wärmepumpen-Klimaanlage ersetzt, kann man den Kredit mit Teilerlass nutzen. KfW wickelt teils die BAFA-Förderung mit ab. |
| Regionale Programme | – Einige Bundesländer und Stadtwerke fördern effiziente Klimatisierung oder Innovationen (z.B. Berlin „Grün heizen, kühlen“ Pilotprogramme). – Oftmals nur im gewerblichen Bereich oder für bestimmte Gebäudetypen (z.B. Denkmalschutz) verfügbar. – Bedingungen sehr unterschiedlich, lokale Energieagenturen informieren. |
Z.B. Energiebonus von Kommunen oder Landeszuschüsse. Häufig Pauschalbeträge (500–1000 €) oder Prozentsätze (10–20 %). Aktuelle Infos bei der jeweiligen Landesbank oder dem örtlichen Versorger erfragen. |
Wichtig: Eine Förderung muss vor Beauftragung der Maßnahme beantragt werden. Informieren Sie sich frühzeitig, ob Ihre geplante Klimaanlage förderfähig ist. Im Privathaushalt ist dies in der Regel nur dann der Fall, wenn es sich um eine Wärmepumpen-Anlage zum Heizen handelt, nicht für eine reine Kühlanlage. Wer also sowieso überlegt, perspektivisch eine neue Heizung anzuschaffen, kann die Kombination aus Heizen und Kühlen in einem System in Betracht ziehen und dafür Förderung nutzen.
Neben BAFA und KfW lohnt auch ein Blick auf Steuervorteile: Handwerkerkosten für die Installation können bis zu 20 % (max. 1.200 € pro Jahr) von der Steuer abgesetzt werden (§35a EStG, Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen). Auch das reduziert indirekt die Kosten.
Umweltaspekte und Energieeffizienz
Beim Thema Klimaanlage darf der Umweltschutz nicht fehlen. Klimageräte verbrauchen Strom und enthalten Kältemittel – beides hat Auswirkungen auf die Umwelt. Darauf sollten Sie achten:
-
Stromverbrauch & Klimawandel: Eine ineffiziente Klimaanlage, die rund um die Uhr läuft, treibt den Stromverbrauch hoch und kann indirekt CO₂-Emissionen verursachen (je nach Strommix). Daher ist die Energieeffizienzklasse ein zentrales Kriterium. Moderne Split-Geräte erreichen oft Klasse A++ oder sogar A+++ im Kühlbetrieb. Veraltete oder billige Geräte können deutlich schlechter sein. Stiftung Warentest gewichtet Umwelteigenschaften (50 %) am stärksten im Klimageräte-Test, z.B. flossen Energieeffizienz und Geräuschentwicklung maßgeblich in die Note ein. Greifen Sie daher zu Geräten mit einem hohen SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio für’s Kühlen) und SCOP (Seasonal Coefficient of Performance für’s Heizen) – je höher, desto besser. Zudem: Nutzen Sie die Anlage bewusst und nicht verschwenderisch. Beispiel: Wenn möglich nachts lüften und tagsüber Sonnenschutz nutzen, sodass die Klimaanlage weniger leisten muss. Jede eingesparte kWh hilft auch der Umwelt.
-
Kältemittel: Klimaanlagen arbeiten mit speziellen Kältemitteln, die Wärme transportieren. Ältere Kältemittel (wie R-410A) haben ein hohes Treibhauspotenzial (GWP über 2000) und dürfen in Neugeräten kaum noch verwendet werden. Aktuelle Geräte setzen auf umweltverträglichere Kältemittel: R-32 (GWP ca. 675, mittel) ist bei vielen Split-Klimas Standard; R-290 (Propan) hat ein extrem niedriges GWP (~3) und wird vermehrt in mobilen Geräten eingesetzt. R-290 ist brennbar, daher hauptsächlich in kleinen Füllmengen (Monoblocks) im Einsatz. Achten Sie darauf, dass Ihr Neugerät ein Kältemittel mit niedrigem GWP nutzt – das ist nicht nur ökologisch besser, sondern oft auch ein Zeichen für moderne Technologie. Entsorgung und Wartung von Altgeräten mit klimaschädlichen Kältemitteln sollten nur Fachbetriebe übernehmen, um Emissionen zu vermeiden.
-
Geräusch und Nachbarschaft: Eine umweltbezogene Komponente ist auch Lärm. Klimaanlagen sollten leise arbeiten – das schont Ihre Nerven und die der Nachbarn. Innen sind < 30 dB(A) im Nachtmodus wünschenswert (flüsterleise Geräte erreichen ~19 dB(A)). Außen sollten die Geräte nachts automatisch auf ein niedriges Betriebsgeräusch schalten, um keine Lärmbelästigung zu verursachen. Viele hochwertige Modelle haben hierfür spezielle Night-Modes. Prüfen Sie die Schallleistungspegel in den technischen Daten. Auch dies floss in Warentests ein (Außengerät-Geräusch als Kriterium).
-
Kühlen mit erneuerbarer Energie: Im Idealfall betreiben Sie Ihre Klimaanlage mit Ökostrom oder eigener Photovoltaik. Gerade tagsüber, wenn die Sonne scheint und es am heißesten ist, liefern Solaranlagen viel Strom – perfekt, um die Klimatisierung zu betreiben. So reduzieren Sie den CO₂-Fußabdruck erheblich. Einige Smart-Home-Systeme können Klimaanlagen sogar gezielt dann laufen lassen, wenn überschüssiger PV-Strom vorhanden ist.
-
Alternative Kühlstrategien: Überlegen Sie auch, ob bauliche Maßnahmen den Kühlbedarf senken können: z.B. Rollläden oder Markisen an heißen Tagen geschlossen halten, Dachboden dämmen, hellen Außenanstrich wählen (reflektiert Sonnenlicht). Jede Maßnahme, die Hitze vom Haus fernhält, reduziert den Einsatz der Klimaanlage. Manchmal kann auch eine Wohnraumlüftung mit Kühlfunktion (Zuluft leicht abgekühlt durch Erdreich oder Kühlregister) eine milde Absenkung der Temperatur bewirken – nicht so stark wie eine Klimaanlage, aber dafür sehr energiearm.
Insgesamt gilt: Eine effizient arbeitende, maßvoll eingesetzte Klimaanlage mit klimafreundlichem Kältemittel ist heute deutlich umweltverträglicher als die „Stromfresser“ vergangener Jahrzehnte. Dennoch sollte Kühlung immer mit Augenmaß erfolgen – im Sinne des Geldbeutels und der Umwelt.
Tipps zur Auswahl des Fachbetriebs
Die beste Klimaanlage nützt wenig, wenn sie falsch dimensioniert oder schlecht installiert ist. Daher ist die Wahl eines geeigneten Fachbetriebs entscheidend. Achten Sie bei der Auswahl des Dienstleisters auf folgende Punkte:
-
Zertifizierung und Qualifikation: Stellen Sie sicher, dass der Betrieb die notwendige Sachkundezertifizierung für Kälte- und Klimaanlagen hat. Nur Firmen mit entsprechend geschultem Personal dürfen mit Kältemitteln arbeiten. Oft sind spezialisierte Kälte-Klima-Fachbetriebe die erste Wahl, da sie täglich Klimaanlagen installieren und über viel Erfahrung verfügen. Auch einige Heizungsbauer bieten Klimageräte an – hier sollten Sie hinterfragen, ob entsprechende Expertise vorhanden ist
. Suchen Sie nach Schlagworten wie „Meisterbetrieb für Kältetechnik“ oder prüfen Sie, ob der Betrieb Mitglied im Fachverband (z.B. Zentralverband Kälte-Klima-Technik) ist.
-
Bedarfsermittlung und Beratung: Ein guter Anbieter kommt zunächst vorbei oder fragt detailliert nach, um die Kühllast zu berechnen und die geeignete Gerätgröße vorzuschlagen. Misstrauen Sie pauschalen Aussagen wie „das 2,5-kW-Gerät passt schon“ ohne Raumdaten. Seriöse Fachleute berücksichtigen Fläche, Raumhöhe, Dämmstandard, Fensterfläche, Sonneneinstrahlung etc. und empfehlen auf dieser Basis ein passendes System. Zudem sollte man Sie zu Alternativen beraten (z.B. ob ein Multisplit für Sie Sinn ergibt oder zwei Single-Splits besser sind).
-
Transparente Angebotserstellung: Lassen Sie sich ein schriftliches Angebot mit allen Posten geben: Gerätepreis, Montagekosten (inkl. Material für Leitungen, Halterungen, Kondensatpumpe falls nötig), Inbetriebnahme, eventuelle Zusatzarbeiten (z.B. Elektroarbeiten, Gerüst wenn nötig) etc. Ein transparenter Kostenvoranschlag schützt vor bösen Überraschungen
. Einige Fachbetriebe bieten Festpreise an, was vorteilhaft sein kann. Holen Sie ruhig mehrere Angebote ein, um Preise und Leistungen zu vergleichen. Der günstigste ist nicht immer der beste – achten Sie auf Detailtiefe des Angebots und Beratungskompetenz.
-
Erfahrungsberichte und Referenzen: Schauen Sie nach Kundenbewertungen (z.B. im Internet) oder fragen Sie im Bekanntenkreis, ob jemand Erfahrungen mit dem Betrieb hat. Bewertungen sollte man mit gewisser Vorsicht genießen, aber sie können ein Stimmungsbild liefern, etwa ob pünktlich und sauber gearbeitet wird
. Manche Firmen nennen auf Anfrage Referenzkunden oder zeigen Projekte, die sie umgesetzt haben – gerade bei größeren Vorhaben kann das hilfreich sein.
-
Service und Wartung: Idealerweise begleitet Sie der Fachbetrieb langfristig. Viele bieten Wartungsverträge an oder zumindest eine jährliche Durchsicht. Es ist praktisch, wenn der Installateur später auch für Service zur Verfügung steht und Ersatzteile besorgen kann. Wählen Sie also jemanden, der nicht nur verkauft und einbaut, sondern auch in ein paar Jahren ansprechbar ist. Im Garantiefall ist es hilfreich, wenn alles aus einer Hand kam (Gerät + Montage), so schieben sich Händler und Monteur nicht gegenseitig die Verantwortung zu
.
-
Zeitliche Flexibilität: Gute Fachbetriebe haben volle Terminkalender. Fragen Sie rechtzeitig an und klären Sie, ob der Einbau vor der heißen Saison möglich ist. Ein Indiz für Professionalität: Der Betrieb macht einen Begehungstermin und nimmt Maß, bevor er ein Angebot abgibt. Wenn sofort am Telefon ein Preis genannt wird, ohne Ihr Haus zu kennen, ist Vorsicht geboten.
-
Garantien: Erkundigen Sie sich nach Garantieleistungen. Üblich sind 2 Jahre Gewährleistung. Manche Hersteller gewähren erweiterte Garantien (5 Jahre auf den Kompressor z.B.), wenn die Installation nachweislich durch einen zertifizierten Betrieb erfolgte und regelmäßige Wartung gemacht wird. Fragen Sie den Fachbetrieb, ob er bei Garantieabwicklung unterstützt.
Kurzum: Vertrauen Sie Ihr Klimaprojekt nur Profis an. Eine falsch installierte Klimaanlage (undicht, falsche Kältemittelmenge, schlechte Platzierung) kann zum Ärgernis werden. Mit einem kompetenten Fachbetrieb haben Sie von der Beratung bis zur Wartung einen Partner, der für ein optimales Ergebnis sorgt.
Checkliste: Klimaanlage nachrüsten
Zum Abschluss finden Sie hier eine Checkliste, die Ihnen bei der Planung und Umsetzung Ihrer Klimaanlagen-Nachrüstung hilft:
-
Raum und Bedarf analysieren: Welche Räume sollen klimatisiert werden? Ermitteln Sie die ungefähre Kühlleistung pro Raum (als Daumenwert z.B. ~60 W/m² bei normal gedämmtem Raum). Dies hilft bei der Geräteauswahl.
-
Passenden Anlagentyp wählen: Entscheiden Sie, ob ein mobiles Gerät ausreicht oder ein Split-System sinnvoller ist. Für mehrere Räume evtl. Multisplit in Betracht ziehen. Wollen Sie zusätzlich Heizen, dann setzen Sie auf eine Wärmepumpen-Klimaanlage.
-
Aufstellort planen: Wo könnte die Inneneinheit montiert werden (hoch an der Wand, nicht über Wärmequellen)? Wo kann die Außeneinheit hin (Balkon, Außenwand, Bodenplatte)? Prüfen Sie Stabilität der Wand und Abstand zu Nachbarn für das Außengerät.
-
Bauliche Machbarkeit prüfen: Klären Sie, wo der Wanddurchbruch erfolgen kann und wie die Leitungen geführt werden (Aufputz-Kabelkanal oder in der Wand? Kondensatablauf?). Müssen Möbel umgestellt werden? Ist eine Kernbohrung möglich (Strom-/Wasserleitungen orten lassen)?
-
Stromversorgung sicherstellen: Gibt es in Nähe der Inneneinheit einen geeigneten Stromanschluss? Falls nein, planen Sie einen Elektroanschluss (vom Sicherungskasten eine Zuleitung legen lassen).
-
Genehmigungen einholen: Als Eigenheimbesitzer meist nicht nötig, aber als Mieter brauchen Sie das OK vom Vermieter. In Eigentumswohnungen die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft einholen, falls Außeneinbau. Bei Reihenhäusern evtl. Nachbarn informieren, um spätere Konflikte zu vermeiden.
-
Fachbetriebe recherchieren: Suchen Sie nach qualifizierten Klimabetrieben in Ihrer Region. Nutzen Sie Bewertungsportale oder Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Erfahrung.
-
Angebote einholen: Lassen Sie vor Ort beraten und sich ein Kostenvoranschlag erstellen. Holen Sie idealerweise 2–3 Angebote ein. Vergleichen Sie Preise und Leistungsumfang (Gerätetyp, Marke, Garantie, inkl. Elektrotechnik?).
-
Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich über mögliche Förderprogramme (BAFA, KfW). Wenn Sie eine Förderung nutzen wollen, unbedingt vor Beauftragung den Antrag stellen! (Sonst entfällt der Anspruch.) Eventuell benötigen Sie dafür Angebote und Nachweise vom Installateur.
-
Auftrag und Termin: Beauftragen Sie den gewählten Betrieb und vereinbaren Sie einen Installationstermin. Planen Sie Puffer ein – wenn es sehr heiß ist, sind Klimafachleute überlaufen. Im Zweifel lieber früh in der Saison installieren lassen.
-
Installation begleiten: Am Tag der Montage sorgen Sie für Zugang (Dachboden, Sicherungskasten etc. bereithalten). Besprechen Sie mit den Monteuren die genaue Position von Innen- und Außengerät. Nach der Installation lassen Sie sich die Funktion erklären.
-
Dokumentation aufbewahren: Sie erhalten in der Regel eine Bedienungsanleitung, das Inbetriebnahmeprotokoll und ggf. den Förderantrag ausgefüllt zurück. Bewahren Sie alles auf. Notieren Sie auch, welches Kältemittel und welche Füllmenge im Gerät ist (steht oft am Typenschild) – wichtig für spätere Wartung.
-
Wartung planen: Vereinbaren Sie ggf. einen ersten Wartungstermin nach 1–2 Jahren oder markieren Sie sich im Kalender die regelmäßige Filterreinigung (z.B. alle 4 Wochen im Sommer). So bleibt die Anlage effizient.
-
Kühlen mit Köpfchen: Nutzen Sie Ihre neue Klimaanlage sinnvoll: Türen und Fenster geschlossen halten beim Kühlen, keine unnötig niedrigen Temperaturen einstellen, Nachtkühlung nutzen, Sonnenschutz tagsüber schließen. So erreichen Sie maximalen Komfort mit minimalen Kosten.
Mit dieser Checkliste sind Sie gut gerüstet, um Ihr Projekt "Klimaanlage nachrüsten" erfolgreich umzusetzen. Denken Sie daran: Eine durchdachte Planung und fachgerechte Umsetzung zahlt sich durch zuverlässige Kühlung, niedrige Betriebskosten und lange Lebensdauer aus. Bald können Sie im Hochsommer die angenehme Kühle in Ihren vier Wänden genießen – gut geplant ist halb gekühlt!
Erfahrungen
Hier Kannst Du einen Kommentar verfassen
Verwandte Beiträge