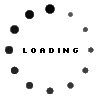Energieberater in der Haftung: Was gilt bei falscher Beratung?
Energetische Sanierungen sind ein wichtiges Thema für Hauseigentümer – sowohl für die Umwelt als auch für den Geldbeutel.
2025-05-05 00:00:00 2025-05-05 00:00:00 admin
Oft zieht man einen Energieberater hinzu, um optimale Maßnahmen zu planen und verfügbare Fördermittel zu nutzen. Doch was passiert, wenn die Beratung fehlerhaft ist? Falsche Empfehlungen oder Versäumnisse können teuer werden. In diesem Artikel erfahren Sie, wer in solchen Fällen haftet und welche rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland gelten. Dabei beleuchten wir sowohl öffentlich geförderte Energieberatungen (z. B. über das BAFA) als auch privat beauftragte Beratungen. Zudem gehen wir auf mögliche Anspruchsgrundlagen, die Rolle des Energieberaters als Sachverständiger, die Energieeffizienz-Expertenliste, Auswirkungen von BAFA-Förderungen auf die Haftung, Unterschiede zwischen Privatkunden und Unternehmen, Absicherungstipps für Hauseigentümer und relevante Gerichtsentscheidungen ein.
Wer haftet bei falscher Energieberatung?
Grundsätzlich gilt: Verursacht ein Energieberater durch falsche Beratung einen Schaden, haftet er dafür. In der Regel ist der Energieberater (bzw. das von ihm vertretene Beratungsunternehmen) gegenüber dem Hauseigentümer verantwortlich, wenn z. B. wichtige Informationen fehlen, falsche Prognosen gestellt oder Fristen versäumt wurden. Vertragsverletzungen – etwa wenn vereinbarte Leistungen unzureichend erbracht werden – begründen eine Haftung ebenso wie Fahrlässigkeit (Verstoß gegen allgemeine Sorgfaltspflichten) auch ohne expliziten Vertrag.
Für Sie als Hauseigentümer bedeutet das: Hat der beauftragte Energieberater Fehler gemacht und entsteht Ihnen dadurch ein finanzieller Schaden (z. B. entgangene Förderung, unnötige Kosten oder Bauschäden), können Sie Schadensersatzansprüche gegen ihn geltend machen. Ist der Energieberater in einer Firma angestellt, haftet meist die Firma als Ihr Vertragspartner. Wichtig zu wissen ist, dass Fördermittelgeber wie BAFA oder KfW selbst in der Regel nicht haften, wenn die Beratung durch den Experten falsch war – der Berater bleibt in der Verantwortung. Die Praxis zeigt, dass Gerichte Energieberater direkt in die Pflicht nehmen, wenn aufgrund von Fehlberatung z. B. staatliche Zuschüsse verloren gehen. Ein Energieberater kann sich also nicht damit entschuldigen, der Bauherr hätte sich selbst informieren müssen – die Richter betonten, dass es gerade seine Hauptpflicht ist, einen laienhaften Verbraucher fachkundig über Richtlinien und Anforderungen zu beraten.
Öffentlich geförderte vs. private Energieberatung
Energieberatungen können privat beauftragt oder durch staatliche Programme gefördert sein. Bei einer öffentlich geförderten Energieberatung (etwa der BAFA-Vor-Ort-Beratung für Wohngebäude oder der begleitenden Beratung für KfW-Förderprogramme) erhält der Eigentümer einen Zuschuss zur Beratungsleistung. Voraussetzung dafür ist jedoch meist, dass ein qualifizierter Sachverständiger die Beratung durchführt. Diese Experten sind speziell geschult und in entsprechenden Listen registriert (mehr dazu unten). Die Beratung erfolgt nach vorgegebenen Standards, und der Berater hilft oft auch bei der Beantragung der Fördermittel. Private Energieberatung meint hingegen, dass der Eigentümer den Berater ohne staatlichen Zuschuss engagiert – dies kann jeder tun, und der Begriff „Energieberater“ ist in Deutschland nicht gesetzlich geschützt. Das heißt, jeder darf sich Energieberater nennen, auch ohne bestimmte Qualifikation.
Für die Haftung macht es jedoch zunächst keinen Unterschied, ob die Beratung gefördert oder privat beauftragt war. In beiden Fällen schuldet der Berater eine fachgerechte, objektiv richtige Beratung. Allerdings gibt es praktische Unterschiede: Bei geförderter Beratung sind die Berater qualifiziert und kennen die Förderbedingungen in der Regel sehr genau – trotzdem können Fehler passieren, etwa wenn Richtlinien missverstanden oder falsch angewendet werden. Ein Vorteil für den Kunden: Die formalen Abläufe (Beratungsbericht, Antragstellung etc.) schaffen eine klare Dokumentation, die im Streitfall als Beweismittel dient. Bei privater Beratung sollten Hauseigentümer besonders auf die Qualifikation achten, da hier auch unqualifizierte oder unseriöse Anbieter am Markt sind. Schäden durch schlechte Beratung können hoch sein und Zuschüsse in Hundert-Euro-Höhe oder mehr betreffen.
Wichtig: Ein öffentlich geförderter Berater ist nicht von der Haftung befreit, nur weil die Beratung bezuschusst war. Der Zuschussgeber (Staat) übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Empfehlungen. Wenn also eine geförderte Vor-Ort-Beratung fehlerhaft ist und z. B. zu Fehlinvestitionen führt, haftet ebenfalls der Berater. Umgekehrt kann auch ein privat beauftragter Berater haftbar sein, wenn er es versäumt, auf mögliche Fördermittel hinzuweisen. Wer Kunden zu staatlicher Förderung berät, muss die Voraussetzungen genau kennen – sonst droht Schadensersatz. Zusammengefasst: In beiden Beratungsformen gilt für den Energieberater das Motto „Sorgfalt ist Pflicht“.
Mögliche Haftungsgrundlagen: vertragliche und deliktische Ansprüche
Tritt ein Schaden durch falsche Beratung ein, stellt sich die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage der Hauseigentümer Ansprüche geltend machen kann. Hier kommen insbesondere vertragliche Haftung und Deliktsrecht (unerlaubte Handlung) in Betracht:
-
Haftung aus dem Beratungsvertrag: In aller Regel schließen Eigentümer und Energieberater einen Vertrag – schriftlich oder konkludent durch Beauftragung. Juristisch ist eine Energieberatungs-Vereinbarung meist als Dienstvertrag (§§ 611 ff. BGB) einzuordnen, da eine Beratungsleistung geschuldet ist. Einige Leistungen eines Energieberaters können auch als Werkvertrag gelten (z. B. die Erstellung eines bestimmten Gutachtens oder Energieausweises als Erfolg). Die Einordnung ist wichtig, weil bei einem Werkvertrag Gewährleistungsrechte und feste Verjährungsfristen greifen, während bei einem Dienstvertrag der Berater „nur“ für Verschulden haftet. In der Praxis bedeutet das: Hat der Berater vertragliche Pflichten verletzt, kann der Auftraggeber Schadensersatz fordern (§§ 280 ff. BGB). Beispiel: Ein Berater verpflichtet sich vertraglich, einen Sanierungsfahrplan zu erstellen, der zu KfW-Zuschüssen berechtigt. Erfüllt er dies falsch oder unvollständig, liegt eine Pflichtverletzung vor – die entstandenen Schäden (z. B. entgangene Förderung) muss er ersetzen. Selbst wenn der Vertrag keine ausdrückliche Erfolgsgarantie enthält, schuldet der Berater eine fachgerechte Leistung nach dem aktuellen Stand der Technik und den einschlägigen Regeln. Versäumt er etwa, einen Förderantrag rechtzeitig einzureichen oder falsche Daten anzugeben, ist das ein Vertragsverstoß.
-
Haftung aus Delikt (unerlaubte Handlung): Unabhängig von einem Vertrag kann ein Energieberater auch nach § 823 BGB haften, wenn er durch Fahrlässigkeit jemandes Rechtsgüter verletzt. In der reinen Beratungsleistung steht meist das Vermögen im Vordergrund (z. B. finanzieller Schaden durch verpasste Einsparungen oder Fördergelder). Reine Vermögensschäden sind außerhalb vertraglicher Beziehungen nur begrenzt ersatzfähig. Allerdings gibt es Konstellationen, in denen Dritte den Aussagen eines Energieberaters vertrauen: Etwa wenn ein Energieausweis fehlerhaft ausgestellt wurde, könnten Käufer oder Mieter des Hauses, die sich darauf verlassen haben, Ansprüche haben. Die Rechtsprechung ist hier nicht einheitlich; es ist umstritten, ob ein Energieausweis ähnlich wie ein Gutachten gegenüber Dritten Haftungswirkung entfaltet. In der Regel ist der geschädigte Hauseigentümer selbst Vertragspartner und wählt den einfacheren Weg über die Vertragshaftung. Dennoch: Sollte kein Vertrag bestehen (z. B. bei einer kostenlosen Erstberatung ohne Auftrag), käme eine deliktische Haftung in Betracht, wenn durch grob falsche Beratung ein Schaden verursacht wird.
In den meisten Fällen werden Hauseigentümer also vertragliche Schadensersatzansprüche geltend machen. Grundlage ist § 280 BGB (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung) in Verbindung mit dem Beratungsvertrag (§ 611 BGB, ggf. i.V.m. § 675 BGB für Auskunfts- und Beratungsverträge). Im Frankenthal-Fall (siehe unten) stützte das Gericht die Haftung ausdrücklich auf den zwischen den Parteien geschlossenen Energieberatungsvertrag. Wichtig: Vertragsansprüche verjähren in der Regel nach 3 Jahren ab Kenntnis des Schadens (spätestens ab Ende des Jahres, in dem der Schaden entstand). Bei werkvertraglichen Mängelansprüchen können sogar kürzere Fristen gelten (oft 2 Jahre ab Abnahme bei Gutachten, 5 Jahre bei Bauwerken). Deshalb sollten Betroffene nicht zu lange warten, um ihre Rechte geltend zu machen.
Energieberater als Sachverständiger: Pflichten eines Experten
Energieberater agieren häufig als Sachverständige für Energieeffizienz. Gerade wenn es um die Bestätigung von energetischen Kennwerten oder das Ausstellen von Nachweisen für Förderprogramme geht, kommt dem Berater die Rolle eines Experten zu. Damit einher geht eine hohe Verantwortung: Der Berater muss die technischen Anforderungen und rechtlichen Rahmenbedingungen genau kennen und korrekt anwenden. Ein Beratender, der über reine Technik hinaus auch zu Fördervoraussetzungen oder gesetzlichen Vorgaben (z. B. Gebäudeenergiegesetz, BEG-Richtlinien) Auskunft gibt, erbringt sogar eine Rechtsdienstleistung im Nebenbereich. Das bedeutet, er muss mit besonderer Sorgfalt agieren, obwohl er kein Jurist ist – andernfalls verletzt er seine Nebenpflichten aus dem Beratungsvertrag.
In der Praxis schuldet ein Sachverständiger fachlich zutreffende Beratung. Die Gerichte haben klargestellt, dass ein Energieberater verpflichtet ist, alle vom Kunden vorgelegten Planungen und Angebote auf ihre energie- und fördertechnische Tauglichkeit zu prüfen. Übersieht er z. B., dass angebotene Bauteile (Fenster, Dämmungen etc.) die geforderten U-Werte nicht erreichen, ist seine Beratung fehlerhaft – mit der Folge, dass er haftet, wenn deshalb Fördermittel entzogen werden. Als Experte darf er sich nicht darauf zurückziehen, der Bauherr könne Details selbst recherchieren – eine solche Argumentation führe das eigene Leistungsversprechen „ad absurdum“, wie ein Gericht deutlich formulierte.
Zusammengefasst: Ein Energieberater muss wie ein sachkundiger Gutachter alle relevanten Aspekte im Blick haben – von bautechnischen Standards bis zu Förderbedingungen. Sein Rat hat oft maßgeblichen Einfluss auf Entscheidungen des Hauseigentümers (Materialauswahl, Investitionshöhe, Antragstellung). Entsprechend streng wird seine Sorgfaltspflicht beurteilt. Verletzt er sie, macht er sich schadensersatzpflichtig. Übrigens: Verletzt ein Berater seine Pflichten grob, kann dies auch berufsrechtliche Konsequenzen haben (etwa Verlust bestimmter Zertifizierungen oder Streichung von Expertenlisten). Für Hauseigentümer ist es daher ratsam, sich nur auf ausgewiesene Experten zu verlassen.
Energieeffizienz-Expertenliste – warum die Eintragung zählt
Bei der Suche nach einem qualifizierten Berater stößt man auf die Energieeffizienz-Expertenliste. Diese Liste, die von der Deutschen Energie-Agentur (DENA) im Auftrag des Bundes geführt wird, verzeichnet zertifizierte Energieberater für Förderprogramme. Warum ist diese Eintragung wichtig? Zum einen ist sie oft Pflicht, um bestimmte Fördergelder zu erhalten – z. B. verlangt die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), dass ein gelisteter Experte den Antrag stellt und die Sanierung fachlich begleitet. Zum anderen signalisiert die Listeneintragung, dass der Berater eine spezielle Schulung absolviert hat und regelmäßig Weiterbildung nachweist. Die Expertenliste vereinheitlicht somit einen Qualitätsstandard in einem Berufsfeld, dessen Berufsbezeichnung an sich nicht geschützt ist.
Für Hauseigentümer bedeutet das konkret: Eintrag in der Expertenliste = geprüfte Qualifikation. Diese Berater haben in der Regel einen Hintergrund als Ingenieur, Architekt oder Handwerksmeister und zusätzliche Fortbildungen im Bereich Energieeffizienz. Sie sind mit aktuellen Normen und Förderbedingungen vertraut und verfügen meist über eine Berufshaftpflichtversicherung (viele Förderprogramme setzen eine solche Versicherung voraus). All das reduziert das Risiko von Fehlberatungen – ausschließen kann es Fehler natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt. Umgekehrt sollte man bei Beratern, die nicht in der Liste stehen, vorsichtig sein. Es heißt nicht automatisch, dass sie unqualifiziert sind, aber man sollte dann umso mehr auf Referenzen und Nachweise achten. Insbesondere wenn Fördermittel ins Spiel kommen, muss ein nicht gelisteter Berater außen vor bleiben, da seine Beratung sonst für Zuschüsse nicht anerkannt wird.
Fazit: Prüfen Sie vor Beauftragung, ob der Energieberater in der Energieeffizienz-Expertenliste geführt ist. Die DENA bietet hierzu eine Online-Datenbank. Ein gelisteter Energieeffizienz-Experte bietet mehr Sicherheit und Expertise. Zudem hätten Sie im Ernstfall die Möglichkeit, Fehlverhalten auch der Liste zu melden. Diese Qualitätssicherung schützt sowohl Fördermittelgeber als auch Hauseigentümer vor Wildwuchs in der Branche.
Haftung bei BAFA-geförderter Energieberatung
Viele Hauseigentümer nutzen Förderprogramme des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), etwa die BAFA-Energieberatung für Wohngebäude (früher Vor-Ort-Beratung) oder Zuschüsse für konkrete Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der BEG. Wie beeinflusst das die Haftung des Beraters? Zunächst gilt: Die BAFA-Förderung ändert nichts an der grundsätzlichen Haftung. Der Berater schließt auch hier einen Vertrag mit dem Eigentümer – nur dass ein Teil der Kosten vom Staat übernommen wird. Der Berater muss gemäß den Förderbedingungen qualifiziert sein (siehe Expertenliste) und bestimmte Berichtspflichten erfüllen. Kommt er dem nicht nach oder berät er falsch, haftet er dem Eigentümer gegenüber wie bei jeder anderen Beratung.
Besondere Brisanz bekommt dieses Thema durch die Konsequenzen, die Fehler in der Beratung bei geförderten Projekten haben können. Oft geht es um viel Geld: Verfehlt eine Maßnahme die Mindestanforderungen der Förderung, kann die Bewilligung entzogen oder gekürzt werden. Das BAFA oder die KfW können bereits zugesagte Mittel streichen, wenn z. B. falsche U-Werte deklariert wurden oder Anträge nicht förderkonform gestellt sind. Für den Hauseigentümer bedeutet das einen unmittelbaren Schaden – er bekommt weniger oder gar kein Geld. In so einem Fall haftet der Energieberater für den Ausfall der Förderung. Genau dies hat das LG Berlin in einem aktuellen Fall entschieden: Weil der Berater bei einer BAFA-geförderten Sanierung die falschen Fenster durchgewinkt hatte, musste er ~6.000 € Schadensersatz in Höhe der entgangenen Förderung zahlen.
Hinzu kommt: Sollte durch die falsche Beratung rechtswidrig eine Förderung erschlichen worden sein, drohen sogar strafrechtliche Konsequenzen (Stichwort Subventionsbetrug). Das klingt dramatisch, betrifft aber vor allem Fälle, in denen Berater und Eigentümer bewusst falsche Angaben machen. Als ehrlicher Hauseigentümer sollten Sie im Fall einer fehlerhaften Beratung, die zu einer Fehlförderung geführt hat, aktiv mit BAFA/KfW kooperieren und ggf. erhaltene Gelder zurückzahlen, sobald der Fehler bekannt wird. So vermeiden Sie juristische Probleme. Ihren finanziellen Schaden – etwa Mehrkosten durch Nachbesserungen oder entgangene Zuschüsse – können Sie dann immer noch vom Berater zurückfordern.
Kurz gesagt: BAFA-Förderung schützt nicht vor Beratungsfehlern, erhöht aber die Anforderungen an den Berater. Achten Sie darauf, dass Ihr Berater alle BAFA-Vorgaben einhält und lassen Sie sich Zwischenschritte (Anträge, Nachweise) zeigen. Bei Unklarheiten ziehen Sie frühzeitig das BAFA oder einen weiteren Experten zu Rate. Im Ernstfall muss der Berater für Fördermittelverlust, Falschinformationen oder Versäumnisse geradestehen – die Gerichte haben hier klare Worte gefunden, dass sich ein Berater bei Förderthemen sehr gut auskennen muss.
Privatperson vs. Unternehmen – Unterschiede in der Haftung
Haftet ein Energieberater anders, je nachdem ob der Auftraggeber Privatperson oder Unternehmen ist? Die rechtlichen Grundlagen der Haftung bleiben zwar gleich – ein Fehler ist ein Fehler – doch es gibt ein paar Unterschiede in der Praxis:
-
Vertragsgestaltung: Private Hauseigentümer schließen meist relativ einfache Verträge (oft vom Berater vorbereitet). Hier gelten die Schutzvorschriften des Verbrauchervertragsrechts. Zum Beispiel dürfen Allgemeine Geschäftsbedingungen keine unangemessenen Haftungsbeschränkungen gegenüber Verbrauchern enthalten. Ein Klausel, die die Haftung für fahrlässige Falschberatung ausschließt, wäre gegenüber einer Privatperson unwirksam. Unternehmen oder professionelle Auftraggeber hingegen können mit dem Berater Haftungsbegrenzungen aushandeln. In größeren Projekten (etwa Wohnungsunternehmen, Bauträger) ist es nicht unüblich, dass die Haftung des Energieberaters vertraglich auf einen bestimmten Betrag oder auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt wird. Solche Vereinbarungen sind unter Kaufleuten eher zulässig. Für Privathaushalte gilt: Sie dürfen erwarten, vollumfänglich schadlos gehalten zu werden, wenn der Berater einen Fehler macht – versteckte Haftungsausschlüsse ziehen hier in der Regel nicht.
-
Kenntnis und Mitverantwortung: Bei Verbrauchern nimmt man an, dass sie Laien auf dem Gebiet sind. Der Berater muss also proaktiv und verständlich alle relevanten Informationen liefern. Unterlässt er einen Hinweis (z. B. auf Fördermöglichkeiten oder Risiken einer bestimmten Sanierungsvariante), kann er sich nicht darauf berufen, der Kunde hätte selbst recherchieren können. Bei geschäftlichen Kunden (z. B. einem Architekturbüro, das einen Energieexperten hinzuzieht) kann die Erwartungshaltung anders sein – dort sitzt eventuell Fachkenntnis auf der Kundenseite, und gewisse Grundkenntnisse werden vorausgesetzt. Die Haftung bleibt zwar bestehen, aber die Schwelle zur Mitverantwortung des Auftraggebers kann niedriger sein. Beispiel: Ein Industrieunternehmen beauftragt einen Energieberater zur Optimierung einer Anlage und liefert falsche Ausgangsdaten. Hier könnte dem Unternehmen ein Mitverschulden angelastet werden, während ein privater Hausbesitzer, der dem Berater alle Unterlagen übergibt, sich auf dessen Prüfung verlassen darf.
-
Schadensumfang: Bei Unternehmen kann ein Beratungsfehler unter Umständen zu höheren Folgeschäden führen (etwa entgangener Gewinn durch ineffiziente Produktion). Solche weiteren Schäden sind zwar dem Grunde nach ebenfalls ersatzfähig, aber oft wird vertraglich eingegrenzt, wofür der Berater haftet. Ein Privathaushalt hat typischerweise klar bezifferbare Schäden: entgangene Förderung, Mehrkosten für Nachrüstung, Wertminderung am Gebäude etc. Diese lassen sich leichter vor Gericht durchsetzen. Großschäden in Millionenhöhe sind im Bereich Wohngebäude-Energieberatung selten – und wenn, dann eher bei institutionellen Bauherren.
In Summe gilt: Privatpersonen genießen einen stärkeren Haftungsschutz, weil Verträge verbraucherfreundlich ausgelegt werden. Unternehmen müssen vertraglich genau hinschauen, was der Berater zusagt und wie die Haftung geregelt ist. Für den durchschnittlichen Hauseigentümer ist es beruhigend zu wissen, dass ein seriöser Energieberater sich seiner Verantwortung bewusst ist – und dass das Recht ihn nicht aus der Pflicht entlässt, egal ob der Kunde „Herr Müller“ oder eine GmbH ist.
Absicherung für Hauseigentümer: So schützen Sie sich
Wie kann man als Hauseigentümer vorbeugen, um gar nicht erst in die Lage zu kommen, einen Energieberater haftbar machen zu müssen? Hier einige praxisnahe Tipps, um sich abzusichern:
-
Qualifizierten Berater wählen: Setzen Sie auf Qualifikation und Erfahrung. Wählen Sie möglichst einen Berater, der in der Energieeffizienz-Expertenliste geführt ist oder einschlägige Zertifikate (z. B. „Gebäudeenergieberater (HWK)“) vorweisen kann. Fragen Sie nach Referenzen oder bereits realisierten Projekten. Ein geprüfter Experte ist keine Garantie, aber er kennt sich mit großer Wahrscheinlichkeit besser aus als ein Quereinsteiger.
-
Schriftlichen Vertrag abschließen: Halten Sie die Leistungsinhalte schriftlich fest. Welche Leistungen werden erbracht (Vor-Ort-Termin, schriftlicher Bericht, Fördermittelbeantragung, Baubegleitung etc.)? Bis wann? Was passiert, wenn sich herausstellt, dass etwas unplausibel ist – korrigiert der Berater dann? Ein klarer Beratungsvertrag verhindert Missverständnisse und dient im Streitfall als Grundlage. Achten Sie darauf, dass keine für Sie nachteiligen Klauseln enthalten sind. Bei Unklarheiten können Sie den Vertrag vorab juristisch prüfen lassen.
-
Haftpflichtversicherung des Beraters nachweisen lassen: Zögern Sie nicht, nach der Berufshaftpflichtversicherung des Energieberaters zu fragen. Seriöse Berater verstehen dieses Interesse und legen eine Bestätigung vor. Eine ausreichende Versicherung ist wichtig, denn falls wirklich ein großer Schaden entsteht (z. B. fünfstellige Förderbeträge), kann ein einzelner Berater das ohne Versicherung kaum ersetzen. Leider haben nicht alle Anbieter eine solche Police. Fehlt sie, überlegen Sie zweimal, ob Sie diesem Berater Ihr Haus anvertrauen.
-
Eigene Dokumentation und Kontrolle: Lassen Sie sich alle Empfehlungen und Berechnungen erläutern und geben Sie sich nicht mit Fachchinesisch zufrieden. Führen Sie Protokoll über Gespräche und bewahren Sie E-Mails/Berichte auf. Wenn der Berater für Sie Anträge stellt, bitten Sie um Kopien. So behalten Sie den Überblick. Vergewissern Sie sich z. B., welche Förderbedingungen gelten und ob alle Unterlagen rechtzeitig eingereicht wurden. Eine einfache Internet-Recherche bei BAFA oder KfW kann schon helfen, grundlegende Anforderungen zu kennen – dann merken Sie eher, falls etwas nicht erwähnt wurde.
-
Zweite Meinung einholen: Im Zweifel schadet es nicht, eine zweite Meinung einzuholen. Das kann eine kurze Nachfrage bei der Verbraucherzentrale (viele bieten Energieberatungen an) oder einem anderen Experten sein. Gerade bei sehr kostspieligen Sanierungsvorhaben ist eine Plausibilitätsprüfung sinnvoll. Beispiel: Wenn ein Berater eine exotische Dämmmethode empfiehlt, die angeblich höchste Förderquoten bringt, kann eine zweite Einschätzung helfen einzuschätzen, ob das seriös ist.
-
Im Schadenfall schnell reagieren: Wenn Sie Anzeichen dafür sehen, dass etwas schiefgelaufen ist (z. B. abgelehnter Förderantrag, offensichtliche Rechenfehler im Bericht, Baumängel aufgrund falscher Planung), sprechen Sie den Berater umgehend darauf an. Manchmal lassen sich Fehler noch korrigieren (etwa Nachanträge stellen oder Maßnahmen anpassen). Sollte der Berater nicht willens oder in der Lage sein, den Schaden gutzumachen, holen Sie rechtlichen Rat ein. Warten Sie nicht zu lange wegen der Verjährungsfristen (meist 3 Jahre). Eine gütliche Einigung kann oft schneller und kostengünstiger sein, aber lassen Sie sich nicht auf Hinhaltetaktiken ein – notfalls muss fristwahrend Klage erhoben werden.
Diese vorbeugenden Schritte können das Risiko minimieren. Letztlich gibt es keine 100%ige Sicherheit, aber informierte und aktive Eigentümer sind deutlich besser geschützt. Sie schaffen damit auch für den Energieberater klare Verhältnisse, was erwartet wird – ein seriöser Berater wird diese Transparenz begrüßen.
Gerichtsurteile: Haftung von Energieberatern in der Praxis
Die Rechtsprechung in Deutschland hat in den letzten Jahren einige wegweisende Urteile zur Haftung von Energieberatern gefällt. Diese verdeutlichen, wie ernst Gerichte Beratungsfehler nehmen und wo die Maßstäbe liegen:
-
LG Frankenthal (Urteil vom 23.11.2023, Az. 7 O 13/23) – „Falscher KfW-Antrag: Energieberater muss zahlen.“ In diesem Fall hatte eine Hausbesitzerin aufgrund des Rats ihres Energieberaters einen Förderantrag bei der KfW gestellt, bevor sie ihr Mehrfamilienhaus in Eigentumswohnungen aufteilte. Der Berater, ein Architekt, hatte empfohlen, die Umwandlung vorzunehmen, aber den Antrag dennoch schon vorher zu stellen. Die KfW lehnte die Auszahlung der Förderung ab, da nur Eigentümer bereits bestehender Eigentumswohnungen antragsberechtigt waren – die Umwandlung nach Antragstellung genügte nicht. Die Hauseigentümerin ging leer aus und verlangte vom Berater Schadensersatz in Höhe der entgangenen Fördermittel (~60.000 €). Das Landgericht gab ihr Recht: Der Energieberater hat seine Pflichten aus dem Beratungsvertrag verletzt, indem er die Fördervoraussetzungen falsch dargestellt hat. Besonders hervorzuheben: Das Gericht stellte klar, dass der Architekt sich nicht darauf berufen kann, er habe „nur technisch“ beraten – sobald er zur Förderbeantragung rät, erbringt er eine rechtliche Beratungsleistung und haftet für deren Richtigkeit. Dieses Urteil, das inzwischen rechtskräftig ist, setzt ein deutliches Signal, dass Energieberater für Fehlinformationen zu Förderprogrammen voll einstehen müssen. Hätte die Kundin den Antrag zum richtigen Zeitpunkt gestellt, wären ihr die Mittel gewährt worden – diesen Differenzschaden muss der Berater nun ersetzen.
-
LG Berlin II (Urteil vom 18.02.2025, Az. 30 O 197/23) – „Fehlerhafte Sanierungsbegleitung kostet den Zuschuss.“ Hier beauftragte ein Hauseigentümer eine Energieberater-Firma, ihn bei einer BEG-geförderten Sanierung zu unterstützen – inklusive Antragstellung und Baubegleitung. Der Antrag wurde vom BAFA bewilligt (20 % Zuschuss für die Gebäudehülle). Während der Umsetzung übersah der Berater jedoch, dass die eingebauten Dachfenster nicht die erforderlichen Dämmwerte erfüllten. Nach Abschluss der Arbeiten strich das BAFA die Förderung für diese Posten – die technischen Mindestanforderungen waren nicht erreicht. Dem Eigentümer entgingen dadurch rund 6.000 € an Zuschuss. Das Gericht verurteilte den Energieberater, diesen Betrag als Schadensersatz zu zahlen. In der Urteilsbegründung hoben die Richter hervor, dass die Beraterfirma ihre Hauptleistungspflicht zur fachlich zutreffenden Beratung verletzt habe. Insbesondere hätte sie die vom Kunden vorgelegten Angebote (für Fenster) auf Förderfähigkeit prüfen müssen. Der Einwand der Firma, der Hausbesitzer hätte sich ja selbst informieren können, wurde scharf zurückgewiesen – so ein Hinweis führe das eigene Leistungsangebot ad absurdum. Zusätzlich hatte die Beraterfirma im Schriftverkehr fälschlich auf das Gebäudeenergiegesetz (GEG) statt auf die strengeren BEG-Vorgaben abgestellt, was ebenfalls als Beratungsfehler gewertet wurde. Dieses Urteil (nicht rechtskräftig, Berufung anhängig) zeigt, dass auch technische Fehler bei der Beratung zu voller Haftung führen.
Diese Beispiele machen deutlich: Gerichte stellen hohe Anforderungen an Energieberater. Fehler bei Förderanträgen oder energetischen Berechnungen führen schnell zur Haftung in Höhe des entstandenen Schadens. Für Hauseigentümer sind das gute Nachrichten – sie haben im Ernstfall juristisch gute Karten, ihren Anspruch durchzusetzen. Gleichwohl bleibt der Ärger und Aufwand eines solchen Prozesses erheblich. Daher ist es im eigenen Interesse besser, schon im Vorfeld einen kompetenten Berater zu wählen und Fehler gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Urteile dienen als Warnung an Berater, ihre Aufgaben äußerst gewissenhaft zu erfüllen, und als Ermutigung für Geschädigte, berechtigte Ansprüche nicht scheuen einzufordern.
Fazit: Die Haftung von Energieberatern bei falscher Beratung ist in Deutschland klar geregelt und wird von den Gerichten konsequent durchgesetzt. Hauseigentümer sollten sich der Rechte bewusst sein, aber idealerweise durch sorgfältige Beraterauswahl und aktive Mitwirkung dafür sorgen, dass es gar nicht erst zum Streitfall kommt. So können energetische Sanierungen mit kompetenter Energieberatung zum gewünschten Erfolg führen – ohne böse Überraschungen.
Quellen: Die im Text gemachten Aussagen stützen sich auf aktuelle Urteile und Fachinformationen, u. a. von anwaltlichen Fachbeiträgen und Gerichtsurteilen (LG Frankenthal 2023, LG Berlin II 2025) sowie Hinweisen der Deutschen Energie-Agentur und Expertenempfehlungen für Bauherren.
Verwandte Beiträge