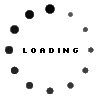Heizungsgesetz nach der Bundestagswahl 2025: Politische Debatten und Konsequenzen für Hauseigentümer
Nach der Wahl, ringen Politik und Öffentlichkeit darum, wie es mit den Vorgaben für klimafreundliches Heizen weitergehen soll.
2025-04-11 00:00:00 2025-04-11 00:00:00 admin
Nach der Bundestagswahl 2025 steht das Gebäudeenergiegesetz (GEG), oft als „Heizungsgesetz“ bezeichnet, erneut im Zentrum der politischen Diskussion. Das in der vergangenen Legislaturperiode mühsam ausgehandelte Gesetz war eines der umstrittensten Projekte der Ampelkoalition. Insbesondere private Hausbesitzer fragen sich, welche Pflichten, Fristen und Förderungen künftig gelten – und ob das Gesetz entschärft oder sogar verschärft wird.
Hintergrund: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024 und seine Vorgaben
Das Gebäudeenergiegesetz in der aktuellen Fassung ist – nach intensiven Kontroversen – Anfang 2024 in Kraft getreten. Sein Ziel ist es, den Klimaschutz im Gebäudesektor voranzubringen, denn noch immer heizen rund 75 % der Haushalte in Deutschland mit Gas oder Öl. Um diesen hohen Anteil fossiler Heizungen zu senken, schreibt das Gesetz mehrere entscheidende Neuerungen vor:
65-Prozent-Regel für neue Heizungen: Künftig sollen alle neu eingebauten Heizungen mit mindestens 65 % erneuerbarer Energie betrieben werden. Das zielt vor allem auf den verstärkten Einsatz von Wärmepumpen, Holzpelletheizungen, Solarthermie und ähnlichen Technologien ab. In Neubaugebieten gilt diese Vorgabe bereits jetzt für neue Heizsysteme.
Bestandsschutz und Übergangsfristen: Entgegen mancher Befürchtung gibt es keine sofortige Austauschpflicht für bestehende funktionierende Öl- oder Gasheizungen. Diese dürfen weiter betrieben und im Fall von Defekten auch repariert werden. Selbst wenn eine alte Heizung irreparabel kaputt geht, räumt das Gesetz den Eigentümern eine Übergangsfrist von fünf Jahren ein, bevor die neue Anlage den 65 %-EE-Anteil erfüllen muss. Von einer abrupten Stilllegung funktionierender Anlagen kann also keine Rede sein.
Kommunale Wärmeplanung als Voraussetzung: Strengere Regeln für Heizungen in Bestandsgebäuden greifen erst, nachdem flächendeckend kommunale Wärmepläne vorliegen. Diese kommunale Wärmeplanung soll den Weg weisen, wo künftig Nah- oder Fernwärmenetze zur Verfügung stehen und wo nicht. In Großstädten müssen solche Pläne bis Mitte 2026, in allen übrigen Kommunen bis Mitte 2028 erstellt werden. Erst danach – also ab etwa 2026/2028 – würden die 65 %-Vorgaben auch bei Heizungswechseln im Bestand verpflichtend werden. Hauseigentümer hätten dann mehr Klarheit, ob ihr Gebäude ans Wärmenetz angeschlossen wird oder ob sie eigenständig auf eine dezentrale Lösung (z. B. Wärmepumpe) umsteigen müssen.
Längerfristige Klimaziele: Perspektivisch soll der Gebäudebestand bis 2045 klimaneutral werden, was bedeutet, dass fossile Heizungen bis dahin sukzessive durch klimafreundlichere Alternativen ersetzt werden müssen. Das GEG ist ein Baustein, um dieses Ziel zu erreichen, und wird auch durch EU-Vorgaben wie die überarbeitete EU-Gebäuderichtlinie beeinflusst.
Großzügige Förderung: Um den Umstieg attraktiver zu machen, hat die Ampelregierung ein umfangreiches Förderprogramm gestartet. Der Staat übernimmt je nach Ausgangslage bis zu 70 % der Investitionskosten (gedeckelt auf 30.000 €) für den Einbau einer klimafreundlichen Heizung. Konkret gibt es einen Basiszuschuss von 30 % und einkommensabhängige Aufschläge sowie Boni für den vorgezogenen Austausch alter Anlagen. Alle privaten Eigentümer – auch Vermieter – können seit Ende 2024 solche Zuschüsse oder Kredite beantragen. Diese Förderung hat vielen die Sorge vor finanzieller Überforderung nehmen sollen und den Heizungstausch sozial abfedern können.
Diese Regelungen wurden allerdings als komplex und bürokratisch kritisiert. Trotz Verbesserungen fühlten sich viele Hausbesitzer von den Detailvorschriften überfordert oder gegängelt und befürchteten hohe Kosten. Tatsächlich führte die monatelange hitzige Debatte 2023/24 zu einer großen Verunsicherung: Zwischenzeitlich brach der Absatz von Wärmepumpen massiv ein, weil viele Verbraucher in einer Art Schockstarre abwarteten, was letztlich Gesetz wird. Nach Verabschiedung des Gesetzes und insbesondere vor der Wahl 2025 kehrte sich der Trend jedoch um: Aus Furcht, dass eine neue Regierung die Zuschüsse kürzen könnte, haben sich zahlreiche Hausbesitzer noch schnell um eine Förderung bemüht und Wärmepumpen bestellt. Diese „Torschlusspanik“ zeigt, wie stark politische Signale die Investitionsentscheidungen im Heizungskeller beeinflussen können.
Politische Debatte: Wie weiter mit dem Heizungsgesetz?
Bereits im Wahlkampf 2025 war das Heizungsgesetz ein zentrales Streitthema. Nach der Wahl stellt sich nun die Frage, ob und wie das GEG geändert wird. In den Koalitionsverhandlungen – aktuellen Berichten zufolge zwischen SPD und Union – prallen unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Einigkeit herrscht bisher nur darin, dass es Anpassungen geben muss; ob diese einer grundlegenden Reform oder einer Abschaffung des Ampel-Gesetzes gleichkommen sollen, ist umstritten. Schauen wir uns die Positionen der wichtigsten Parteien im Einzelnen an, insbesondere im Hinblick auf Austauschpflichten, Fristen, Förderungen und Technologieoffenheit:
SPD: Überarbeitung statt Abschaffung
Die SPD will am Grundgedanken des GEG festhalten, aber das Gesetz bürgerfreundlicher ausgestalten. Konkret strebt sie einen „Praxischeck“ an – eine Überprüfung also, welche Vorschriften entschlackt und vereinfacht werden können, ohne die Klimaziele zu gefährden.
Die SPD betont, dass das Gesetz ohnehin bald wieder angepasst werden muss, um EU-Vorgaben zur Gebäudeeffizienz umzusetzen. Daher spricht viel dafür, die Gelegenheit zu nutzen, um nationale Regeln praxistauglicher zu machen. Grundsätzlich steht die SPD-Bundestagsfraktion nach wie vor hinter dem Heizungsgesetz. Die sozialdemokratische Linie ist: Klimaschutz im Wärmesektor ja – aber mit Augenmaß und sozialer Ausgewogenheit. So verweist die SPD darauf, dass die kommunale Wärmeplanung und umfangreiche Förderungen zentrale Elemente bleiben müssen, um den Umstieg auf erneuerbare Heizungen für die breite Masse machbar und bezahlbar zu halten. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) forderte bereits vor der Wahl eine grundlegende GEG-Reform: Das Gesetz müsse „viel, viel einfacher“ werden.
In ihrem Wahlprogramm zur Wärmewende setzte die SPD zudem auf gemeinschaftliche Lösungen: Der Ausbau klimaneutraler Wärmenetze soll Vorrang haben vor Einzelheizungen, um ganze Viertel effizient zu versorgen. Fördermittel möchte die SPD vor allem jenen zugutekommen lassen, „die sich den Umstieg sonst nicht leisten können“ – also eine stärkere soziale Staffelung der Zuschüsse. Außerdem plant sie Maßnahmen wie Heizungs-Leasingmodelle für ärmere Haushalte und eine Preisaufsicht, um bezahlbare Fernwärme sicherzustellen. Insgesamt signalisiert die SPD also Bereitschaft zur Korrektur im Detail, aber Ablehnung eines radikalen Kurswechsels. Ein komplettes Kippen des Heizungsgesetzes, wie von der Opposition gefordert, lehnen führende Sozialdemokraten ab; stattdessen wollen sie die Akzeptanz durch Vereinfachung erhöhen.
CDU/CSU: Kurswechsel mit Technologieoffenheit
Die Union (CDU/CSU) hat bereits im Wahlkampf deutlich gemacht, dass sie einen Paradigmenwechsel beim GEG anstrebt. „Wir schaffen das Heizungsgesetz der Ampel ab. Mit dem bürokratischen Reinregieren in den Heizungskeller muss Schluss sein“ – diese markigen Sätze aus dem Unions-Wahlprogramm ließen keinen Zweifel daran, dass eine Regierung unter CDU-Führung das Ampel-Gesetz rückgängig machen würde. Nach der Wahl fordert die Union nun einen grundlegenden Kurswechsel in der Wärme- und Klimapolitik.
Konkret möchte die CDU/CSU die GEG-Novelle von 2024 zurücknehmen und zum vorherigen Rechtsstand (GEG 2020) zurückkehren. Das hätte zur Folge, dass zum Beispiel die bereits früher beschlossene Einschränkung für Ölheizungen ab 2026 gelten würde – aber eben ohne die strengen 65 %-EE-Vorgaben der Ampel. Die Union will das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen und setzt auf „klare Rahmenbedingungen“ statt Detailvorgaben.
Zentrale Schlagworte der Unions-Strategie sind CO₂-Bepreisung, Förderung und Technologieoffenheit. Anstatt Hausbesitzern exakt vorzuschreiben, welche Heiztechnik sie einbauen dürfen, sollen verschiedene Wege zu klimaneutraler Wärme offenstehen. Die Aussage „Die neue Heizung muss klimafreundlich betrieben werden können – und dafür gibt es unterschiedliche Wege: Wärmepumpe und Wärmenetze genauso wie nachhaltige Holzpellets, Solarthermie, Geothermie oder grüne Gase“ unterstreicht den Anspruch der Union, Technologieoffenheit zu gewährleisten. Insbesondere will man synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff und Bioenergie als Optionen erhalten, anstatt allein auf Strom/Wärmepumpen zu setzen.
Außerdem plant die Union eine stärkere Steuerung über den CO₂-Preis. Dieser soll schrittweise steigen (wie ohnehin EU-weit vorgesehen) und so fossiles Heizen teurer machen – allerdings sozial abgefedert durch einen Pro-Kopf-Klimabonus oder niedrigere Strompreise. Tatsächlich verspricht das Unionsprogramm, Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung an Bürger und Wirtschaft zurückzugeben, zunächst indem Stromsteuer und Netzentgelte gesenkt werden. Für Immobilienbesitzer interessant: Investitionen in Klimaschutz und Energieeffizienz sollen steuerlich leichter absetzbar sein, und energetische Sanierungen könnten bei Erbschaft- und Schenkungssteuer begünstigt werden.
Die Union kritisiert auch die bisherige Förderpraxis. Nach Aussagen von Jens Spahn (CDU) habe das Ampel-Heizungsgesetz Millionen Hauseigentümer verunsichert, und man werde es zurückdrehen. Geplante Änderungen bei Förderungen: Laut Spahn will die Union die Förderung für den Heizungstausch deutlich kürzen – allerdings „ohne Ungleichheiten durch die Hintertür der Förderregeln“. Es solle weiterhin Unterstützung für klimafreundliche Heizungen geben, aber wohl weniger üppig und einfacher strukturiert. Statt 40–70 % Zuschuss für wenige könnte es zum Beispiel breite steuerliche Anreize oder einen einheitlichen Bonus geben. Die genauen Konditionen sind aber noch offen.
In den laufenden Koalitionsgesprächen zeichnete sich ab, dass SPD und CDU einen Kompromiss suchen, der GEG und kommunale Wärmeplanung enger verzahnt. Es wird diskutiert, statt auf Primärenergie stärker auf Emissionswerte eines Gebäudes über den Lebenszyklus abzustellen. Das hieße: Nicht mehr nur der aktuelle Energieverbrauch, sondern die Gesamt-CO₂-Bilanz eines Gebäudes (inklusive Bau und Sanierung) soll Maßstab werden. Das könnte ein Paradigmenwechsel sein, den die Union favorisiert. Allerdings ist unklar, wie schnell sich das umsetzen ließe. Fest steht: Die Forderung der CDU nach Abschaffung des Ampel-Gesetzes steht im Raum, doch da sie für die Regierungsbildung auf die SPD angewiesen ist, wird am Ende wohl ein Reformgesetz herauskommen, das Elemente beider Seiten vereint. Selbst in Unionskreisen spricht man eher von einer „GEG-Novelle“ als von einer ersatzlosen Streichung.
Grüne: Festhalten am Klimakurs
Die Grünen – in der letzten Regierung Hauptarchitekten des Heizungsgesetzes – wollen an dessen Kurs im Grunde festhalten. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grünen-Kanzlerkandidat 2025) räumte zwar Kommunikationsfehler ein, hält das inhaltliche Anliegen aber weiterhin für richtig. Im Wahlprogramm der Grünen heißt es unmissverständlich: „Die Energie- und Wärmewende setzen wir fort.“ Das bedeutet: Keine Aufweichung der 65 %-Regel, sondern konsequente Fortsetzung der Maßnahmen, um von Öl und Gas wegzukommen. Die Grünen wollen die bestehenden Regelungen so beibehalten, wie sie sind, und setzen stattdessen lieber auf bessere Kommunikation und Unterstützung.
Besonders betonen die Grünen die Notwendigkeit, die Wärmewende sozial gerecht zu gestalten. Sie planen, Förderprogramme für Heizungstausch und Sanierung stärker nach Einkommen zu staffeln – wer wenig verdient, soll einen höheren Zuschuss bekommen als Wohlhabendere. Zudem fordern sie eine Entlastung bei den Energiepreisen: Einen großen Teil der Einnahmen aus dem CO₂-Preis möchte man als Klimageld an Bürger mit geringem und mittlerem Einkommen auszahlen. Ein solcher Auszahlungsmechanismus wurde bereits vorbereitet und könnte nun genutzt werden.
Die Grünen widersprechen vehement den Ideen, das Heizungsgesetz zurückzudrehen. Fraktionschefin Katharina Dröge warnte jüngst: Eine Abkehr vom geltenden Gesetz bedeute faktisch, dass CDU-Chef Merz und SPD-Chef Lars Klingbeil sich vom Klimaziel 2030 verabschieden. „Deutschland hängt beim Klimaschutz im Gebäudebereich ohnehin hinterher, Rückschritte wären hier verantwortungslos“, so Dröge. Zudem würde ein Aus für das Heizungsgesetz Chaos bei Millionen von Bürgern, Kommunen und Unternehmen auslösen – „so etwas ist Gift für die Wirtschaft“. Diese deutlichen Worte zeigen, dass die Grünen jede Abschwächung als Rolle rückwärts sehen, die den bereits angeschlagenen Vertrauensrahmen endgültig zerstören könnte.
Da die Grünen aller Voraussicht nach nicht an der neuen Regierung beteiligt sind, nehmen sie die Rolle der Opposition ein. Sie werden darauf drängen, dass die vereinbarten Klimaziele eingehalten werden und jede Neufassung des GEG mindestens genauso ambitioniert bleibt wie zuvor. Insbesondere bei den Fristen und Zielmarken (z. B. vollständige Klimaneutralität bis 2045) dürften die Grünen mahnen, dass diese nicht verwässert werden. Auch an der aktuellen Bundesförderung für effiziente Heizungen wollen sie festhalten – eher ausbauen statt abbauen. In Summe stehen die Grünen für Kurs halten statt Kurswechsel: Sie argumentieren, dass Planungssicherheit und Tempo nötig sind, um das Vertrauen der Industrie und der Verbraucher in die Wärmewende zu stärken und Deutschland zum Technologieführer bei klimafreundlichen Heizungen zu machen.
FDP: Marktbasierte Lösungen statt Vorschriften
Die FDP war Teil der Ampel und hat 2023 maßgeblich Einfluss auf das Heizungsgesetz genommen. Dennoch verfolgt sie nun – außerhalb der Regierung – einen deutlich liberaleren Ansatz. Ihr Motto lautet „Freiheit im Heizungskeller“. Die FDP möchte die starren Vorgaben des GEG 2024 auslaufen lassen und stattdessen komplett auf marktwirtschaftliche Instrumente setzen. „Das Heizungsgesetz mit seinen überzogenen Vorgaben muss vollständig auslaufen“, heißt es im FDP-Wahlprogramm klar.
Konkret propagiert die FDP einen einzigen großen Lenkungsmechanismus: den CO₂-Emissionshandel. Dieser soll alle bisherigen Detailvorschriften ersetzen. Die Idee dahinter: Wenn der CO₂-Preis stark genug steigt, lohnt sich der Umstieg auf erneuerbare Heizungen von selbst, ohne dass man Verbote oder Quoten braucht. Folgerichtig fordert die FDP, sämtliche Energiesteuern und Umlagen perspektivisch durch den CO₂-Preis zu ersetzen. Gleichzeitig soll es eine Klimadividende geben, das heißt die Staatseinnahmen aus dem Emissionshandel würden gleichmäßig pro Kopf an die Bürger zurückgezahlt. Dieses Modell (auch Klimageld genannt) würde insbesondere Menschen mit kleinem CO₂-Fußabdruck finanziell belohnen.
In der Zwischenzeit lehnt die FDP jedwede Zwangsmaßnahme ab. Einen Anschlusszwang an Fernwärme etwa wollen die Liberalen explizit ausschließen. Bürger sollen frei entscheiden können, ob sie ans städtische Netz gehen oder eine eigene Heizung betreiben. Heizen mit Holz (z. B. Scheitholz oder Pellets) solle „weiter möglich bleiben“, Auflagen für Kaminöfen will die FDP „reduzieren“. Damit positioniert sie sich als Garant dafür, dass auch traditionelle oder alternative Heizformen ihren Platz haben.
Darüber hinaus spricht sich die FDP für eine Ausweitung heimischer Energiequellen aus – auch kontroverse. Fracking-Gas in Deutschland und eine Wiederbelebung der Kernenergie (inklusive neuer Reaktortechnologien) schließt das Programm ausdrücklich ein. Die bisherige Förderung für erneuerbare Energien würde sie abbauen, um Marktverzerrungen zu vermeiden. Stattdessen möchte die FDP private Investitionen erleichtern, z. B. durch Kredite für altersgerechte Sanierung und weniger Bürokratie bei Modernisierungen.
In Summe steht die FDP also für eine maximale Entschärfung des Heizungsgesetzes: Weg mit verbindlichen Austauschpflichten, stattdessen Klimaschutz über den Preis und durch Innovation. Allerdings hat die FDP – mit nur rund 7–8 % Stimmen – derzeit nicht die politische Schlagkraft, dies alleine umzusetzen. Sollte sie in der Opposition bleiben, wird sie jedoch vehement darauf drängen, dass die neue Koalition keine neuen Verbote erlässt und marktgetriebene Lösungen (CO₂-Handel, Wettbewerb der Technologien) einbezieht. Für Hausbesitzer bedeutet die FDP-Position die größtmögliche Freiheit bei der Heizungswahl – aber eben auch, dass der Preis für fossile Energien steigen dürfte und weniger direkte Zuschüsse vom Staat zu erwarten wären.
Weitere Parteien: Linke und AfD
Auch die Linke und die neue Liste von Sahra Wagenknecht (BSW) sowie die AfD haben Position bezogen, spielen jedoch in der Gesetzgebung voraussichtlich eine geringere Rolle.
Die Linke kritisiert das Heizungsgesetz aus sozialer Sicht: Sie möchte, dass Klimaschutz nicht auf dem Rücken der Mieter und Geringverdiener ausgetragen wird. Ihre Forderungen umfassen bezahlbare Energiepreise durch staatliche Eingriffe (z. B. soziale Tarife, Preisdeckel) und eine Warmmieten-Neutralität bei Sanierungen. Zwangssanierungen lehnt sie ab, außer es gibt umfassende Förderung. Die Modernisierungsumlage will die Linke streichen. Statt profitgetriebener Versorger soll eine gemeinwirtschaftliche Energieversorgung ausgebaut werden. Im Grunde fordert die Linke also mehr Schutz für Verbraucher und eine stärkere öffentliche Hand bei der Wärmewende. Im neuen Bundestag ist die Linksfraktion allerdings voraussichtlich klein, ihre Einflussmöglichkeiten sind begrenzt.
Die AfD dagegen leugnet den menschengemachten Klimawandel und würde das Heizungsgesetz am liebsten ersatzlos abschaffen. Ihre Vorstellungen laufen den Klimazielen diametral entgegen: Sie setzt auf eine Rückkehr zu Kohle- und Kernkraftwerken sowie Gas und will den Ausbau erneuerbarer Energien bremsen oder sogar Windräder wieder abbauen. Für private Hauseigentümer verspricht die AfD damit zwar keinerlei neue Auflagen – allerdings würde ihr Kurs die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zementieren. Angesichts internationaler Verpflichtungen Deutschlands ist die AfD-Position in der Realität kaum umsetzbar. Dennoch kann ihre Rhetorik Verunsicherung schüren, denn sie stellt die Notwendigkeit der Wärmewende grundsätzlich infrage.
Konsequenzen für private Hauseigentümer
Für Immobilienbesitzer und Eigenheimbesitzer ist die aktuelle Situation nicht einfach. Viele fragen sich: Soll ich jetzt in eine neue Heizung investieren oder abwarten? Was, wenn ich gerade eine Förderung beantragt habe und das Gesetz geändert wird? Und welche Fristen und Pflichten gelten nun konkret für mich? Hier die wichtigsten Punkte, die Hauseigentümer nach der Wahl beachten sollten:
Bestehende Pflichten gelten bis auf Weiteres weiter: Solange keine Neufassung beschlossen ist, bleibt das GEG 2024 in Kraft. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Heizungstausch planen, gelten die aktuellen Regeln (z. B. 65 %-Vorgabe in Neubauten, Bestandsschutz für laufende Geräte, 5-Jahres-Frist bei Totalausfall). Auch die Förderkonditionen bleiben zunächst bestehen – und die Regierung hat bereits signalisiert, dass die Förderung bei einem neuen Gesetz erhalten bleiben soll. Ein abrupter Stopp des Zuschussprogramms ist unwahrscheinlich, da dies massive Proteste hervorrufen würde. Im Gegenteil: Bis auf Weiteres fördert die KfW den Austausch alter Heizungen gegen klimafreundliche Alternativen mit mindestens 30 % Zuschuss (teils bis 70 %). Wer förderberechtigt ist, sollte diese Mittel auch nutzen – ungenutzte Fördergelder helfen weder dem Klima noch dem eigenen Portemonnaie.
Keine Panik bei funktionierender Heizung: Private Eigentümer, die eine funktionierende Öl- oder Gasheizung haben, müssen nicht sofort austauschen. Weder das alte GEG noch wahrscheinliche neue Varianten sehen einen Zwang vor, intakte Anlagen vorzeitig stillzulegen. Allerdings bleibt die bereits länger geltende Regel bestehen, dass über 30 Jahre alte Kessel (Standard-Heizkessel älter als 1995) ausgetauscht werden müssen – diese Austauschpflicht stammt schon aus früheren Verordnungen und dient der Effizienz. Wer also einen sehr alten Kessel besitzt, sollte unabhängig von den neuen Debatten über eine Modernisierung nachdenken. Für alle anderen gilt: Man kann proaktiv umrüsten (und hohe Fördergelder mitnehmen), muss aber nicht sofort.
Kostenentwicklung im Blick behalten: Experten weisen darauf hin, dass das Heizen mit fossilen Energien in Zukunft teurer wird – unabhängig von Gesetzen. Denn der CO₂-Preis im Wärmesektor steigt schrittweise an, was Heizöl und Erdgas verteuert. Schon ab 2027 greift ein verschärfter Emissionshandel in der EU, der die Brennstoffpreise nach oben treiben dürfte. Das bedeutet: Selbst wenn politische Vorgaben gelockert werden, kann ein Festhalten an der alten Gasheizung wirtschaftlich riskant sein. Moderne Wärmepumpen oder Holzpelletheizungen könnten sich mittelfristig rechnen, weil sie keinen oder weniger CO₂-Aufpreis zahlen müssen. Hausbesitzer sollten diese langfristigen Trends in ihre Überlegungen einbeziehen – nicht nur die Rechtslage.
Planungssicherheit vs. Abwarten: Die aktuelle Debatte löst bei vielen Eigentümern eine Zwickmühle aus: Einerseits benötigt man Planungssicherheit, andererseits könnte ein neues Gesetz manche heute sinnvolle Investition überflüssig machen. Verbraucherschützer warnen jedoch davor, Entscheidungen allein aufgrund vager Wahlversprechen aufzuschieben. „Wenn Verbraucher eine neue Heizung benötigen, brauchen sie vor allem Planungssicherheit.“ Die Grundlage dafür bietet das derzeit gültige Gesetz und das bekannte Fördersystem. Abwarten ist nur dann ratsam, wenn die bestehende Heizung noch einige Jahre zuverlässig läuft und man flexibel reagieren kann. Wer aber in absehbarer Zeit eine Anschaffung planen muss (etwa weil der Kessel 25+ Jahre alt ist oder bereits Störungen zeigt), sollte nicht auf den letzten Drücker warten. Zum einen ist unklar, ob eine neue Regierung großzügigere Übergangsfristen gewährt als die derzeitigen fünf Jahre bei Ausfall – es könnten genauso gut strengere Effizienzstandards kommen, nur eben anders geartet. Zum anderen besteht das Risiko, bei einem plötzlichen Defekt ohne Plan dazustehen.
Technologieoffenheit nutzen – aber realistisch bleiben: Falls die neue Koalition wie angekündigt Technologieoffenheit stärker betont, könnten Hausbesitzer künftig mehr Auswahl beim Heizungstausch haben. Zum Beispiel könnte es akzeptiert werden, einen neuen Gas-Brennwertkessel einzubauen, sofern man sicherstellt, dass dieser später mit grünem Gas oder Wasserstoff betrieben wird. Schon das Ampel-Gesetz ließ solche Optionen unter Bedingungen zu, wurde aber von vielen als „Faktisches Verbot“ von Gasheizungen verstanden. Eine Öffnung hier würde kurzzeitig Erleichterung bringen – etwa für Eigentümer alter Gebäude, bei denen der Einbau einer Wärmepumpe technisch schwierig ist. Allerdings warnen viele Experten: Auf breiter Front mit grünem Wasserstoff zu heizen, ist in den nächsten Jahren unrealistisch, da die Mengen und Netze fehlen. Ebenso ist Holz nur begrenzt verfügbar und ökologisch nicht überall sinnvoll. Hausbesitzer sollten daher genau prüfen, welche Technologie für ihren Fall zukunftssicher ist. Die Wärmepumpe bleibt aus Expertensicht in gut gedämmten Häusern eine sehr effiziente Lösung, während etwa in unsanierten Altbauten ein Anschluss ans Fernwärmenetz oder eine Holzpelletheizung eine Option sein kann.
Zusammengefasst sollten private Hauseigentümer informiert und wachsam bleiben, aber nicht in Hektik verfallen. Das bestehende Heizungsgesetz bietet bereits einige Flexibilität für Bestandsheizungen und großzügige Hilfen für Modernisierer. Diese Basis wird vermutlich zumindest bis 2026 fortgelten, ggf. mit kleineren Anpassungen. Wer jetzt handelt, geht kein großes Risiko ein: Selbst falls bestimmte Vorschriften gelockert werden, wird niemand bestraft, der frühzeitig auf eine klimafreundliche Heizung umgestiegen ist – im Gegenteil, man hat sichere Fördergelder und geringere CO₂-Kosten. Wer hingegen noch wartet, sollte die politische Entwicklung genau verfolgen und rechtzeitig planen, um nicht irgendwann ohne Förderung oder unter Zeitdruck investieren zu müssen.
Gesetzgebungsverfahren und nächste Schritte
Die Zukunft des Heizungsgesetzes hängt maßgeblich von den anstehenden Koalitionsvereinbarungen und dem parlamentarischen Prozess ab. Stand Mitte 2025 ist eine neue Regierungskoalition noch in der Findungsphase – aktuell verhandeln SPD und CDU/CSU über ein Bündnis. In diesen Verhandlungen wurde ein mögliches Konzeptpapier bekannt, das auf Emissionseffizienz statt Energieverbrauch als Maßstab setzen könnte. Noch ist jedoch keine endgültige Einigung erzielt. Medienberichte über eine schon beschlossene Abschaffung des Heizungsgesetzes erwiesen sich als verfrüht; tatsächlich stehen die Positionen teils noch unvereinbar gegenüber.
Wie geht es also weiter? Einige Punkte zum Ausblick und Verfahren:
-
Zeitplan der Novelle: Es ist unwahrscheinlich, dass noch 2025 ein vollständig neues GEG in Kraft tritt. Eher rechnen Insider mit einem GEG 2026. Erste Stimmen aus Verhandlerkreisen deuten an, dass die komplexe Verzahnung mit der Wärmeplanung und EU-Vorgaben mehr Vorlauf braucht. Realistisch dürfte eine Gesetzesvorlage im Laufe von 2025 sein, die dann im Parlament beraten wird. Eine Verabschiedung könnte Ende 2025 oder Anfang 2026 erfolgen, je nachdem wie schnell Konsens gefunden wird. Bis dahin gilt: Status quo (GEG 2024) bleibt gültig.
-
Einbindung der Bundesländer: Da das GEG auch den Ländern obliegt (Bundesratspflicht), werden die Bundesländer ein Wörtchen mitreden. Einige Länder hatten schon 2023 Bedenken wegen der Umsetzbarkeit der kommunalen Wärmeplanung innerhalb der Fristen geäußert. Es ist möglich, dass im Bundesrat auf realistischere Fristen gedrängt wird, falls die neuen Vorgaben als zu ambitioniert gelten. Andererseits haben grün mitregierte Länder ein Interesse, die Standards nicht zu sehr zu senken.
-
Europäische Vorgaben: Die EU arbeitet an einer Novelle der Gebäuderichtlinie. SPD-Politiker haben angedeutet, dass diese EU-Richtlinie bis 2026 in deutsches Recht umgesetzt werden muss. Diese Richtlinie könnte zum Beispiel Mindest-Energieeffizienzklassen für Gebäude festlegen. Sollte das so kommen, müsste Deutschland ohnehin gesetzlich aktiv werden – unabhängig von der aktuellen GEG-Debatte. Völlige Untätigkeit ist also keine Option.
-
Nächste Schritte der Regierung: Sobald die Koalitionspartner sich auf Kernpunkte einigen, wird das federführende Ministerium einen Referentenentwurf erarbeiten. Dieser geht dann in die Ressortabstimmung und später in die Verbändeanhörung, wo Handwerksverbände, Industrie, Umweltverbände, Verbraucherschützer etc. Stellung nehmen. Schon bei der letzten GEG-Runde 2023 gab es intensive Anhörungen, die zur Nachbesserung beigetragen haben. Auf der anderen Seite wird zum Beispiel der Deutsche Städtetag darauf drängen, dass Kommunen ausreichend Zeit für die Wärmeplanung bekommen und dass Klimaziele nicht aufgeweicht werden. Nach der Anhörungsphase könnte der Gesetzentwurf offiziell im Bundestag eingebracht werden.
-
Parlamentarische Beratung: Im Bundestag dürfte die erste Lesung eines neuen GEG-Entwurfs frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2025 stattfinden. Danach geht der Entwurf in die Ausschüsse, wo es weitere Anhörungen mit Sachverständigen gibt. Wenn alles glatt läuft, könnte ein neues Gesetzespaket bis Sommer 2026 beschlossen sein – was mit den erwähnten Planungsfristen (2026 für Großstädte) koinzidieren würde.
Mögliche Inhalte des neuen Gesetzes: Zwar sind Details noch nicht beschlossen, aber die Richtung der Debatte lässt einige Wahrscheinlichkeiten erkennen. Erstens, es wird vermutlich weniger starre Einzelvorschriften geben, dafür übergeordnete Ziele. Ein Ansatz ist, Gebäudeeigentümern bestimmte Emissions-Grenzwerte oder Effizienzklassen vorzugeben, die sie bis zu einem Stichtag erreichen müssen – den Weg dorthin können sie selbst wählen. Zweitens, die Förderung wird bleiben, aber eventuell neu justiert. Es könnte mehr über steuerliche Förderung laufen und weniger über einmalige Zuschüsse, um Bürokratie zu reduzieren. Drittens, die kommunale Wärmeplanung wird vermutlich entflechtet bzw. synchronisiert. Möglich wäre, dass man Regelungen trifft, was passiert, wenn Gemeinden ihre Wärmepläne nicht fristgerecht liefern – damit Eigentümer nicht endlos im Ungewissen bleiben. Viertens, man wird versuchen, die Kommunikation zu verbessern. Ein großer Kritikpunkt am alten Heizungsgesetz war, dass viele Mythen (etwa vom „Heizungsverbot“) umgingen. Die neue Regierung wird Wert darauf legen, die Bürger frühzeitig und transparent zu informieren, um Vertrauen zu schaffen.
Fazit
Der „Heizungsgesetz“-Streit geht in die nächste Runde, aber völlig unreguliert wird der Wärmesektor nicht bleiben. Private Hauseigentümer tun gut daran, die politische Entwicklung aufmerksam zu verfolgen, zugleich aber die bestehenden Möglichkeiten zur energetischen Sanierung zu nutzen. Klarheit über die endgültigen Regeln dürfte erst 2026 herrschen – bis dahin sollte man sich auf Übergangsregelungen einstellen. Experten mahnen, die erneute Diskussion nicht endlos auszudehnen, da jede Unsicherheit dem Klimaschutz und der Wirtschaft schadet. Die Heizungsindustrie hat Investitionen auf Basis der beschlossenen Regeln getätigt und warnt eindringlich vor einer „Rolle rückwärts“. Auch Verbraucherschützer nennen die aktuelle Debatte „kontraproduktiv“, weil sie Entscheidungen verzögert.
Für Hausbesitzer heißt das Fazit: Sie können mit vorsichtigem Optimismus nach vorne blicken. Wahrscheinlich wird das neue Gesetz mehr Flexibilität bieten und Härtefälle entschärfen, ohne das Ziel des klimafreundlichen Heizens aufzugeben. Die großzügigen Förderungen dürften in irgendeiner Form weiterlaufen – es besteht also kein Grund, panisch zu werden. Gleichzeitig ist die langfristige Richtung klar: Weg von fossilen Heizungen hin zu erneuerbaren Wärmelösungen, ob nun via Wärmepumpe, Fernwärme oder andere Technologien. Wer diese Wärmewende im eigenen Keller rechtzeitig angeht, wird auf Dauer profitieren – durch niedrigere Betriebskosten, Wertsteigerung der Immobilie und einen Beitrag zum Klimaschutz. Die Politik ringt derweil um den richtigen Rahmen, aber eines ist sicher: Das Heizungsthema bleibt auf der Agenda, und die nächsten Entscheidungen in Berlin werden maßgeblich bestimmen, wie fair und erfolgreich die Wärmewende für private Eigentümer verläuft. Bleiben Sie also informiert – wir halten Sie auf dem Laufenden über den Fortgang im Gesetzgebungsverfahren und die konkreten Auswirkungen für Ihr Zuhause.
Erfahrungen
Hier Kannst Du einen Kommentar verfassen
Verwandte Beiträge